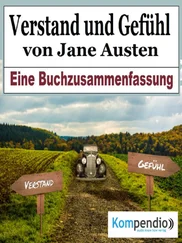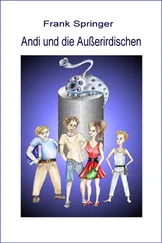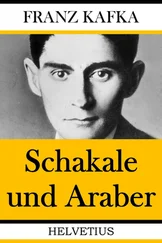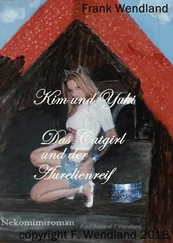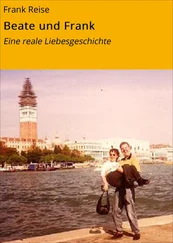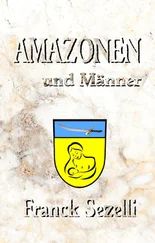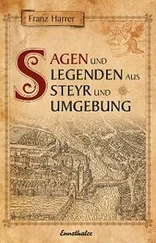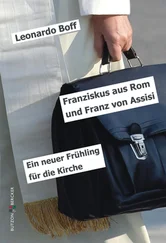ACM (2016). Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache 18/8965). Verfügbar unter: https://www.cannabis-med.org/nis/data/file/stellungnahme_acm_2016.pdf(abgerufen am 21.08.2019)
ACM-Mitteilungen (2017). Die weniger bekannte Geschichte des Gesetzes. Verfügbar unter: http://www.cannabis-med.org/german/acm-mitteilungen/ww_de_db_cannabis_artikel.php?id=227#8(abgerufen am 21.08.2019)
Bundesverfassungsgericht (2000). 2 BvR 2382/99. Verfügbar unter: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2000/01/rk20000120_2bvr238299.html(abgerufen am 21.08.2019)
Bundesverwaltungsgericht (2005). BVerwG 3 C 17.04. Verfügbar unter: https://www.bverwg.de/190505U3C17.04.0(abgerufen am 21.08.2019)
Bundesverwaltungsgericht (2016). Erlaubnis zum Eigenanbau von Cannabis zu therapeutischen Zwecken. BVerwG 3 C 10.14. Verfügbar unter: https://www.bverwg.de/060416U3C10.14.0(abgerufen am 21.08.2019)
Deutscher Bundestag (1995). Bundestagsdrucksache 13/3282. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Barbara Höll und der Gruppe der PDS – Drucksache 13/3021 – Medizinischer Gebrauch von Cannabis. Verfügbar unter: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/032/1303282.pdf(abgerufen am 21.08.2019)
Deutscher Bundestag (2016). Bundestagsdrucksache 18/8965. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften. Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/089/1808965.pdf(abgerufen am 21.08.2019)
Deutscher Bundestag (2017). Bundestagsdebatte zum Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 19. Januar 2017. Deutscher Bundestag lässt Cannabis als Medizin für Patienten zu. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=krgVq4qUUnM(abgerufen am 21.08.2019)
Deutscher Bundestag (18. Januar 2017). Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit (14. Ausschuss). Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810902.pdf(abgerufen am 21.08.2019)
Deutscher Bundestag (19. Januar 2017). Bundestag lässt Cannabis-Arzneimittel für schwerkranke Patienten zu. Verfügbar unter: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw03-de-betaeubungsmittel/487044(abgerufen am 21.08.2019)
Flenker I (1997). Grußwort zur Tagung Cannabis und Cannabinoide als Medizin am 22. November 1997, Köln. Tagungsband.
Goedecke H, Karkos J (1996). Die arzneiliche Verwendung von Cannabisprodukten. Bundesgesundheitsblatt 39, 206–209
Grotenhermen F (2018). The German medical cannabis law of 2017. Drugs Alcohol Today 18(2), 117–122.
Oberlandesgericht Karlsruhe (2004). Gerichtsurteile. Verfügbar unter: http://www.cannabis-med.org/index.php?tpl=page&id=59&lng=de(abgerufen am 21.08.2019)
Oberverwaltungsgericht Münster (2012). Gerichtsurteile. Verfügbar unter: http://www.cannabis-med.org/index.php?tpl=page&id=59&lng=de(abgerufen am 21.08.2019)
THC Pharm. Geschichte. Verfügbar unter: http://www.thc-pharm.de/geschichte-2/(abgerufen am 21.08.2019)
II
Grundlagen
1 Zahlen und Fakten zum Cannabiskonsum in Deutschland
Bernd Werse
Auch wenn das Potenzial für die medizinische Nutzung von Cannabis für Deutschland auf eine sechsstellige Zahl von Patientinnen und Patienten geschätzt wird (Plenert 2016), so dürfte die sogenannte Freizeitnutzung (engl. recreational use ), also die Verwendung zu Rauschzwecken, auch bei umfassender medizinischer Versorgung die häufigste Art des Cannabisgebrauchs bleiben. Daher ist es wichtig, eine Idee davon zu haben, wie weit die Droge in der Allgemeinbevölkerung verbreitet ist. Von besonderem Interesse sind dabei Jugendliche und junge Erwachsene – eine Altersgruppe, in der in aller Regel der Erstkonsum der Droge stattfindet und in der insbesondere dann, wenn sich frühzeitig ein regelmäßiger Konsum einstellt, sich am ehesten ein problematisches Gebrauchsmuster entwickeln kann. Um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ist es zudem hilfreich, eine ungefähre Vorstellung von möglichen Trendentwicklungen in der Cannabisverwendung zu haben.
1.2 Zur Aussagekraft unterschiedlicher Datenerhebungen
Tatsächlich bieten vorliegende Daten aber stets nur eine mehr oder weniger gute Annäherung an die soziale Realität, vor allem aufgrund von folgenden Problemen:
 Polizeidaten, z.B. die Anzahl der „erstauffälligen Konsumenten harter Drogen“ oder die Anzahl „konsumnaher Delikte“, werden nicht selten als Abbild der tatsächlichen Verbreitung betrachtet. Tatsächlich bilden diese aber in erster Linie die Kontrollschwerpunkte der Polizei ab. Dieses Thema hat in jüngster Zeit an Relevanz gewonnen, da insbesondere die „konsumnahen Delikte“ im Zusammenhang mit Cannabis in Deutschland in jedem der letzten Jahre um jeweils rund 10% gestiegen sind (vgl. BKA 2018). Was auch immer der Grund für diese Steigerung sein mag: dokumentiert ist hiermit ein Anstieg der Kriminalisierung von Konsumierenden und nicht etwa ein Anstieg der Verbreitung des Cannabiskonsums (vgl. auch Werse 2018).
Polizeidaten, z.B. die Anzahl der „erstauffälligen Konsumenten harter Drogen“ oder die Anzahl „konsumnaher Delikte“, werden nicht selten als Abbild der tatsächlichen Verbreitung betrachtet. Tatsächlich bilden diese aber in erster Linie die Kontrollschwerpunkte der Polizei ab. Dieses Thema hat in jüngster Zeit an Relevanz gewonnen, da insbesondere die „konsumnahen Delikte“ im Zusammenhang mit Cannabis in Deutschland in jedem der letzten Jahre um jeweils rund 10% gestiegen sind (vgl. BKA 2018). Was auch immer der Grund für diese Steigerung sein mag: dokumentiert ist hiermit ein Anstieg der Kriminalisierung von Konsumierenden und nicht etwa ein Anstieg der Verbreitung des Cannabiskonsums (vgl. auch Werse 2018).
 Repräsentativbefragungen können erhebliche Unterschiede in ihren Ergebnissen aufweisen, je nachdem welche Erhebungsmethode eingesetzt wird – so werden bei telefonischen Befragungen gerade für Cannabis weitaus geringere Konsumraten ermittelt als bei schriftlichen, insbesondere klassengestützten Schülerbefragungen. Das hängt einerseits mit den weitaus geringeren Ausschöpfungsquoten zusammen, andererseits auch mit einer geringeren Bereitschaft der Befragten, tatsächlich eigenen Drogenkonsum zuzugeben. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um aktuellen Konsum handelt, der bei derartigen Befragungen weniger zugegeben wird als ein Gebrauch, der bereits länger zurückliegt (vgl. Werse 2016).
Repräsentativbefragungen können erhebliche Unterschiede in ihren Ergebnissen aufweisen, je nachdem welche Erhebungsmethode eingesetzt wird – so werden bei telefonischen Befragungen gerade für Cannabis weitaus geringere Konsumraten ermittelt als bei schriftlichen, insbesondere klassengestützten Schülerbefragungen. Das hängt einerseits mit den weitaus geringeren Ausschöpfungsquoten zusammen, andererseits auch mit einer geringeren Bereitschaft der Befragten, tatsächlich eigenen Drogenkonsum zuzugeben. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um aktuellen Konsum handelt, der bei derartigen Befragungen weniger zugegeben wird als ein Gebrauch, der bereits länger zurückliegt (vgl. Werse 2016).
 Intensiven, potenziell problematischen bzw. behandlungsbedürftigen Konsum zu quantifizieren, ist mittels Repräsentativerhebungen sehr schwierig, da zumeist für die „Problemgruppen“ nur geringe Fallzahlen erreicht werden, deren Schwankungen oft auf Zufällen beruhen. Zudem fallen Intensivkonsumierende nicht selten aus dem Schulsystem und sind generell weniger bereit, an Befragungen teilzunehmen.
Intensiven, potenziell problematischen bzw. behandlungsbedürftigen Konsum zu quantifizieren, ist mittels Repräsentativerhebungen sehr schwierig, da zumeist für die „Problemgruppen“ nur geringe Fallzahlen erreicht werden, deren Schwankungen oft auf Zufällen beruhen. Zudem fallen Intensivkonsumierende nicht selten aus dem Schulsystem und sind generell weniger bereit, an Befragungen teilzunehmen.
 Auf der anderen Seite ist es problematisch, sich zur Abschätzung von Intensivkonsum auf die Nachfrage nach Beratung und Therapie (etwa: Thaller et al. 2017) zu beziehen, da sich die konkreten Angebote und auch die Bereitschaft, solche zu konsultieren, stark unterscheiden. Therapieangebote für Cannabis Konsumierende wurden seit Ende der 1990er-Jahre deutlich ausgebaut; gleichzeitig ist auch die Nachfrage angestiegen. Letzteres ist deshalb folgerichtig, weil es zuvor viele Regionen gab, in denen gar keine oder zu wenige Beratungs- und Behandlungsangebote für Cannabis Konsumierende existierten, weshalb viele Menschen mit entsprechenden Problemen gar keine Möglichkeiten hatten, sich professionell helfen zu lassen. Ob aber der Anstieg der Nachfrage nur mit dem Anstieg der Angebote zu tun hat oder ob die Anzahl hilfebedürftiger Cannabiskonsument*innen tatsächlich angestiegen sein könnte, kann mit den verfügbaren Daten nicht geklärt werden.
Auf der anderen Seite ist es problematisch, sich zur Abschätzung von Intensivkonsum auf die Nachfrage nach Beratung und Therapie (etwa: Thaller et al. 2017) zu beziehen, da sich die konkreten Angebote und auch die Bereitschaft, solche zu konsultieren, stark unterscheiden. Therapieangebote für Cannabis Konsumierende wurden seit Ende der 1990er-Jahre deutlich ausgebaut; gleichzeitig ist auch die Nachfrage angestiegen. Letzteres ist deshalb folgerichtig, weil es zuvor viele Regionen gab, in denen gar keine oder zu wenige Beratungs- und Behandlungsangebote für Cannabis Konsumierende existierten, weshalb viele Menschen mit entsprechenden Problemen gar keine Möglichkeiten hatten, sich professionell helfen zu lassen. Ob aber der Anstieg der Nachfrage nur mit dem Anstieg der Angebote zu tun hat oder ob die Anzahl hilfebedürftiger Cannabiskonsument*innen tatsächlich angestiegen sein könnte, kann mit den verfügbaren Daten nicht geklärt werden.
Читать дальше
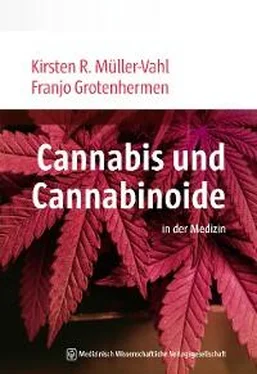
 Polizeidaten, z.B. die Anzahl der „erstauffälligen Konsumenten harter Drogen“ oder die Anzahl „konsumnaher Delikte“, werden nicht selten als Abbild der tatsächlichen Verbreitung betrachtet. Tatsächlich bilden diese aber in erster Linie die Kontrollschwerpunkte der Polizei ab. Dieses Thema hat in jüngster Zeit an Relevanz gewonnen, da insbesondere die „konsumnahen Delikte“ im Zusammenhang mit Cannabis in Deutschland in jedem der letzten Jahre um jeweils rund 10% gestiegen sind (vgl. BKA 2018). Was auch immer der Grund für diese Steigerung sein mag: dokumentiert ist hiermit ein Anstieg der Kriminalisierung von Konsumierenden und nicht etwa ein Anstieg der Verbreitung des Cannabiskonsums (vgl. auch Werse 2018).
Polizeidaten, z.B. die Anzahl der „erstauffälligen Konsumenten harter Drogen“ oder die Anzahl „konsumnaher Delikte“, werden nicht selten als Abbild der tatsächlichen Verbreitung betrachtet. Tatsächlich bilden diese aber in erster Linie die Kontrollschwerpunkte der Polizei ab. Dieses Thema hat in jüngster Zeit an Relevanz gewonnen, da insbesondere die „konsumnahen Delikte“ im Zusammenhang mit Cannabis in Deutschland in jedem der letzten Jahre um jeweils rund 10% gestiegen sind (vgl. BKA 2018). Was auch immer der Grund für diese Steigerung sein mag: dokumentiert ist hiermit ein Anstieg der Kriminalisierung von Konsumierenden und nicht etwa ein Anstieg der Verbreitung des Cannabiskonsums (vgl. auch Werse 2018).