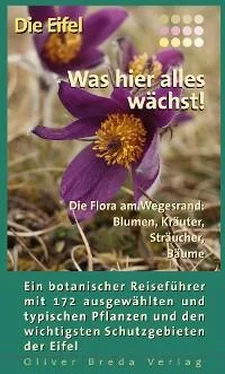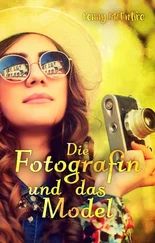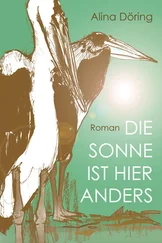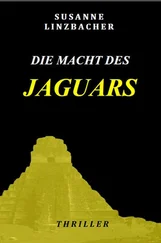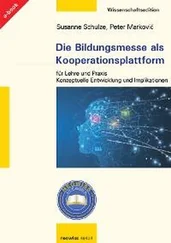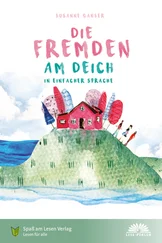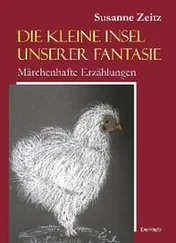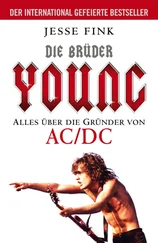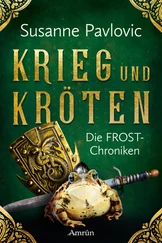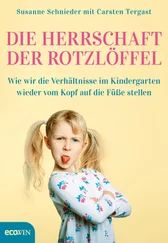Magerwiesen-Margerite
Leucanthemum vulgare
Blütezeit
Mai bis September.
Merkmale
Die auffallend großen Korb-blüten der Margerite sitzen einzeln auf kniehohen Stän-geln. Sie bestehen aus mehre-ren hundert winzigen Röhren-blüten im Zentrum und einem äußeren Kranz aus gut 20 lan-gen, weißen Zungenblüten. Die Laubblätter sind spatelför-mig, die unteren oft gezähnt, die oberen eher glattrandig.
Standort:
Als Zierde der Bergwiesen ist die Margerite in der Eifel weit verbreitet und während der Blüh-saison fast überall zu beobachten.
Wissenswertes:
Margeriten sind von großem Interesse für die Molekulargenetik. Während ihre nordafrikani-schen Verwandten der Gattung Rhodanthemum diploid sind, also die normalen zwei Chromo-somensätze (von jedem Elternteil einen) haben, sind europäische Margariten polyploid. Sie besit-zen bis zu 22 Chromosomensätze. Im Verlauf des Eiszeitalters ist nämlich in Europa immer wieder das Erbgut von Margeritenarten, die aufgrund von Klimaveränderungen räumlich aufeinander-trafen, durch Hybridisierung miteinander ver-schmolzen. So sind die derzeit 42 ausgewiesenen Arten der Gattung Leucanthemum (davon vier in Mitteleuropa) nur schwer voneinander zu tren-nen. Oft werden sie zur Gruppe der Wiesen-Mar-geriten zusammengefasst.
35



Wiesen und Rasen
Ohnhorn, Fratzenorchis
Orchis anthropophora
Blütezeit
Ende Mai bis Anfang Juni.
Merkmale
Auf den ersten Blick nicht sogleich den Knabenkräutern zuzuordnen, bildet das Ohn-horn einen hohen, schmalen Blütenstand. Die bis über 30 Einzelblüten sind zartgrün bis bräunlich. Sie bilden einen kleinen, blassen Helm mit röt-lichen Streifen, aus dem unten die stark zerfurchte, rötliche Lippe heraushängt.
Standort:
Diese wärmeliebende Orchidee ist typisch für die Kalkkuppen der Nordeifel und z.B. am Bür-venicher Berg zu finden, aber auch in den Ge-rolsteiner Dolomiten.
Wissenswertes:
Der Name Ohnhorn (auch Ohnsporn) bezieht sich auf das Fehlen eines Blütensporns. So er-reichen auch Insekten mit kurzen Mundwerk-zeugen den Nektar, weshalb die Pflanze zu den wenigen mitteleuropäischen Orchideen zählt, die von Käfern bestäubt werden. Hingegen entspringen Bezeichnungen wie Fratzenorchis, Puppenorchis oder Hängender Mensch ebenso wie der Artname »anthropophora« (griech. an-thropos = Mensch) der Phantasie der Betrachter, die in der Blütengestalt eine Puppe oder einen Menschen erkennen wollen. Früher gehörte das Ohnhorn in die eigene Gattung Aceras. Moleku-largenetische Untersuchungen führten in jün-gerer Zeit zur Einstufung in die Gattung Orchis.
36




Wiesen und Rasen
Fliegenragwurz und Bienenragwurz
Ophrys insectifera, O. apifera
Blütezeit
Ende Mai bis Mitte Juni (O. insectifera), Anf. Juni bis Anf. Juli (O. apifera).
Merkmale
Diese Orchideen sind mit rund 20 cm Höhe zierlich. Weni-ge, große Blüten stehen an Ähren. Bei der Fliegenragwurz ist deren überdimensiona-le Lippe schokoladenbraun, überragt von drei hellgrünen Kelchblättern. Die bunteren Blüten der Bienenragwurz haben eine gefleckte Lippe und rosafarbene Kelchblätter.
Standort:
Beide Arten lieben vergleichbare Standorte, nämlich Kalkmagerrasen. Am Kuttenberg bei Eschweiler gedeihen sie gemeinsam. Die Bie-nenragwurz ist z.B. auch am Bürvenicher Berg, die häufigere Fliegenragwurz am Niesenberg sowie am Baumberg bei Wiesbaum zu sehen.
Wissenswertes:
Bei der Fliegenragwurz ist der Name irrefüh-rend. Nicht eine Fliege, sondern eine Wespe ahmt die Blüte nach. Dadurch und durch die Abgabe eines Duftstoffs werden Männchen der Ragwurz-Zikadenwespe zur Bestäubung angelockt, die glauben, sie würden ein Weib-chen begatten. Insgesamt kommt es in Mit-teleuropa eher selten zu dieser »Pseudokopu-lation«. Meist findet bei der Fliegenragwurz Selbstbestäubung statt. Bei der Bienenragwurz ist diese ohnehin die Regel. Dabei bewegen sich die gestielten Pollenpakete selbstän-dig nach unten, um die Narbe zu berühren.
37




Wiesen und Rasen
Kleiner Klappertopf
Rhinanthus minor
Blütezeit
Mai bis September.
Merkmale
An bis zu 30 cm langen Stän-geln sitzen gezähnte, rötlich überlaufene Blätter. Auch die Stängel sind rötlich, ebenso die Kelchblätter, aus denen die orangegelben Rachenblü-ten nur halb herausschauen. Der Große Klappertopf (Rhi-nanthus angustifolius) hat zitronengelbe Blüten mit einer lilafarbenen Spitze.
Standort:
Sowohl auf Magerwiesen auf Kalk als auch in Heiden ist der Kleine Klappertopf zu Hause, beispielsweise am Hönselberg, am Baumberg bei Wiesbaum, im Kalksumpf bei Ripsdorf, in der Sistig-Krekeler Heide und im Rohrvenn. Hingegen bevorzugt der Große Klappertopf feuchte Niedermoorwiesen.
Wissenswertes:
Da sich Angehörige der Gattung Rhinanthus oft miteinander kreuzen und zudem das Erschei-nungsbild mit den Jahreszeiten und Standorten stark variiert, können selbst Spezialisten die Ar-ten kaum sicher auseinanderhalten. Ihren Na-men verdanken die Klappertöpfe dem Geräusch, das der Wind beim Durchrütteln der reifen Sa-menkapseln erzeugt. Klappertöpfe zählen zu den Halbschmarotzern. Sie zapfen die Wurzeln be-nachbarter Pflanzen an. Die Bauern scholten sie früher »Milchdiebe«, da wertvollere Futterkräu-ter neben ihnen nicht so recht gedeihen wollten.
38






Arnika
Читать дальше