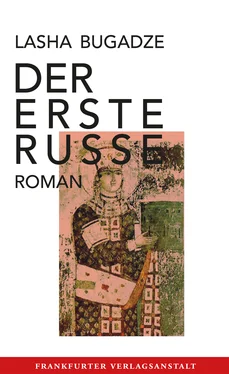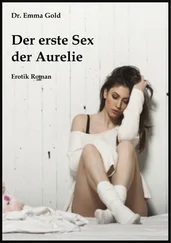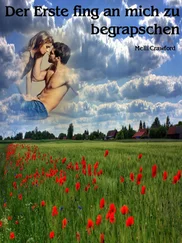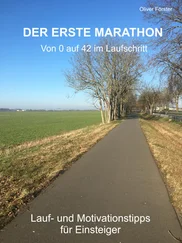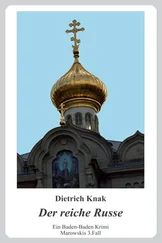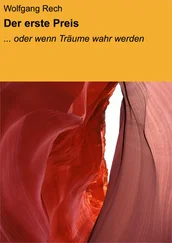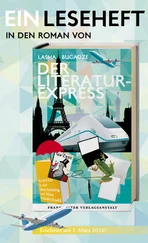Als ich diese Begebenheit in ihrer Gegenwart meinem Vater erzählte, verteidigte sie, damit wir sie nicht der Verklemmtheit bezichtigten, ziemlich laut ihren Standpunkt und gab demjenigen, der es wissen wollte, zu verstehen, dass man schlau genug hätte sein sollen, seinen Enkeln beizeiten die Augen und Ohren zuzuhalten, »egal, ob sie so alt sind wie dieses Kind oder viel älter«, dann hätten sie sich nämlich nicht im Stil der Filmmörder gegenseitig auf der Straße umgebracht.
Diesmal musste mir keiner die Ohren zuhalten – die Leute rannten nur in Scharen aus dem Saal. Als ob da ein Mörder auf der Bühne stände!
»Worüber machst du dich lustig, du Missgeburt?«, schrie jemand vom Ende des Saales her. »Über unsere Geschichte? Unsere Sprache?«
Die, die dageblieben und nicht fluchend davongerannt waren, fühlten sich alle merkwürdig glücklich, dass diese furchtbaren Wörter im frostigen, schäbigen Saal der Universität so laut und kategorisch zu hören gewesen waren. Als hätten die jahrelang verbotenen Wörter und die Wut ihre Daseinsberechtigung wiedergefunden. Dabei hätte ich mich eigentlich unwohl fühlen müssen, wie kurz vor meiner Ankunft hier, als ich mich beim Wasserballtraining in der Umkleide verspätete (wahrscheinlich hatte ich mich mit dem Fuß in der Hose verheddert oder die Badekappe nicht rechtzeitig gefunden) und der Trainer mich so laut rief, dass es das ganze Schwimmbecken hören konnte: »Was ist los, hast du etwa gewichst?« Als Antwort verkündete ich am selben Tag zu Hause, nie wieder zum Wasserball zu gehen (das war sowieso nur die nächste Idee meiner Mutter nach dem Weg der heiligen Nino gewesen, und ich konnte es kaum erwarten, mich vor dem Ganzen wieder zu drücken). Meine Mutter interessierte es außerordentlich, was mein Lehrer denn zu mir gesagt haben könnte, ich konnte mir aber überhaupt nicht vorstellen, den Wortlaut in ihrer Gegenwart zu wiederholen. »Sag es deinem Großvater«, schlug sie am Ende vor (ich dachte, was drängt sich diese Frau mir denn so auf), aber auch ihm gegenüber fiel es mir schwer, die Frage des Trainers zu wiederholen, nur dass mein Großvater mit seiner ihm eigenen kompromisslosen Art den Trainer sogar noch übertraf: »Hat er ›Ich ficke deine Mutter‹ gesagt?«
»Nein …«
»Hat er ›Ich ficke deinen Vater‹ gesagt?«
»Nein, Opa …«
»Hat er ›Fickt ihr euch in den Arsch?‹ gesagt?«
»Oh Mann, natürlich nicht!«
Ich kapierte nicht mal seine Fragen.
»Was für einen Scheiß hat er denn zu dir gesagt?«
Damit dieser Albtraum von Befragung endlich endete, musste ich den Grund meiner Aufregung offenbaren, deshalb überwand ich mich und wiederholte deutlich die Bemerkung des Trainers.
Mein Großvater wurde nicht wütend, er gab nur einen kurzen, unklaren Kommentar ab oder eher einen Laut: »Oh.«
Schon komisch, aber während mich jenes gar nicht mal so skandalöse Wort vom Schwimmbecken noch in die Flucht geschlagen hatte, fesselte mich diesmal die mittlerweile legitime und rückhaltlose Obszönität, das hundertmal ausgesprochene verbotene Wort an den Stuhl und faszinierte mich zudem dermaßen, dass ich bedauerte, nicht anstelle des Redners auf der Bühne zu stehen. Offenbar waren wir nicht gekommen, um einen literarischen Abend, sondern einen Racheakt zu erleben. Es stellte sich heraus, dass wir ein tödliches verbales Raketenabwehrsystem hatten: die grausame und bis zur Krankhaftigkeit aufrichtige Sprache, eine Waffe, die sich der Geschichte der Unterdrückung entgegenstellte.
Niemand rührte den Redner an – es hätte ja jemand auf die Bühne stürmen und den Sprachbeleidiger mit einem Fußtritt runter in den Saal befördern können! Aber nein. Diejenigen, die dageblieben waren, schrien ihn an, ließen ihn aber bis zum Schluss lesen. Er harrte wie ein unantastbarer Heiliger vor einer riesigen Tafel aus (auf der ungeachtet dessen, dass es fast März war, geschrieben stand: »Liebe Studenten, wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr«) und fuhr ungestört fort, uns zu beleidigen: »Ficken! Ficken! Ficken!«
Denjenigen, die flohen, war klar, dass sie den zeitgenössischen georgischen Schriftsteller ein für alle Mal hassen würden; diejenigen, die blieben, waren so beflügelt, dass sie kilometerweit zu Fuß bis nach Hause laufen würden (was sie wahrscheinlich sowieso hätten tun müssen, weil es keinen Nahverkehr gab).
»Mein Lieber«, mein Vater tippte dem Redner auf die Schulter, »das hier war ein längst überfälliger, ehrlicher Protest, eine der besten Aktionen der letzten Jahre! Hervorragend! Du siehst ja, wie die Leute durchdrehen! Die wachen erst auf, wenn die eine Ohrfeige verpasst bekommen.«
»Das war meine Rache«, erwiderte er und wischte sich mit dem Handgelenk über die verschwitzte Stirn, »Zahn um Zahn. Wir wollen doch kein Maschinengewehr in die Hand nehmen!«
Der Priester im Flugzeug. Februar 2002
Meine Tasche kommt aus der Röntgensicherheitskontrolle, ich stecke den Pass in die Hosentasche, fädele den Gürtel durch die Schlaufen und versuche, meinen Blick von dem schnaufenden georgischen Priester hinter mir abzuwenden, der von schwarz gekleideten, fülligen Frauen begleitet wird. »Megi, Megi«, der Blick des Priesters irrt umher, »wo ist mein Telefon?« – »Hier«, antwortet Megi, die ihre Schuhe hatte ausziehen müssen und nun mit blauen Tüten an den Füßen und abgespreizten Armen neben einer Grenzbeamtin steht. Megi hat in jeder Hand ein Telefon.
Ich lege schnell die georgische Sprache ab. Als ob ich nichts mehr verstünde und nichts mehr sähe. Ich muss mir was überlegen, damit mich dieser Mann nicht sieht. Er erinnert mich an meine Ängste eine Woche zuvor: an den dunklen Garten des Patriarchats, die schwach gelblich beleuchteten Flure und den Geruch von Weihrauch drinnen im Patriarchat. Ich fühle mich verfolgt. Ich denke: Wohin kehre ich zurück? Warum kehre ich zurück? Nach einer Weile sehe ich ihn zusammen mit einer zwei Köpfe kleineren Frau durch den Duty-free des Istanbuler Flughafens schlendern. Die dicke, agile Megi schreit durch den ganzen Flughafen: »Vater Bessarion, möchtest du Schokolade oder sonst was?« Nicht möchten Sie , sondern möchtest du . Wahrscheinlich sind sie zusammen zur Schule gegangen.
Ich komme aus Mailand, wohin ich sieben Tage nach meiner Nicht-Reue gefahren war. Ich habe kein Geld mehr beziehungsweise gerade so viel, um mir davon ein Wasser kaufen zu können. Unter fremden Leuten fühle ich mich ruhiger als unter meinen Landsleuten, die am Gate Istanbul–Tbilissi zusammengepfercht sind.
Ich besteige das Flugzeug, setze mich in die erste Reihe, Megi und die Frauen quetschen sich hinter mich. Diese Megi hat dicke Arme, sie stopft die Tasche eifrig ins Gepäckfach, Vater Bessarion möchte in der Businessclass sitzen.
Ein kleiner Vorhang trennt meinen Sitzplatz von seinem. Ich sehe, wie die Flugbegleiterin gekühlte Getränke reicht und er auf komische Art Alkohol verlangt: »Bitte, hier, Whisky.«
Danach schließt sich der Vorhang.
Ich stelle mich schlafend: Ich habe sogar meinen Mund leicht geöffnet, damit es glaubhaft wirkt.
Das Flugzeug rollt auf die Startbahn, die Besatzung ist angeschnallt, plötzlich steht eine alte Georgierin auf, öffnet das Gepäckfach und versucht, eine Tasche herauszunehmen. Die alte Frau wird zurück auf ihren Platz gesetzt. »Ich dachte, ich könnte vielleicht was essen«, sagt sie. Ihr Telefon ist ebenfalls nicht ausgeschaltet. Sie versteht weder in ihrer Mutter- noch in Gebärdensprache, dass Telefone nicht benutzt werden dürfen. Ich weiß jetzt schon, wenn sie es ihr am Ende doch begreiflich machen, wird sie sagen, sie wisse nicht, wie man das Telefon ausschaltet, und wird es weinend irgendwem in die Hand drücken: »Ich weiß es doch nicht, mein Sohn hat es mir gegeben.« Aber es gibt Schlimmeres als das, denn wir alle haben eine große gemeinsame Angst – vor einigen Monaten sind in New York zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme gekracht, und jedes leicht unangemessene Verhalten kommt uns anormal und verdächtig vor. Die alte Frau wird auf ihren Sitzplatz verfrachtet, ich schließe die Augen, höre ihre Stimme – sie erzählt der jungen Frau neben ihr: »Fünf Jahre lang bin ich nicht in Georgien gewesen, mein Neffe ist gestorben, außer mir haben sie niemanden mehr, ich kümmere mich um meinen betagten Bruder …«
Читать дальше