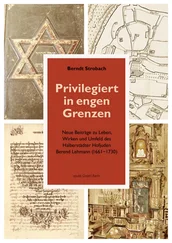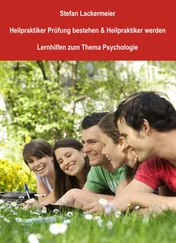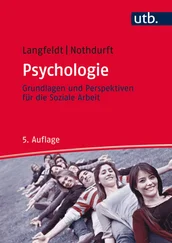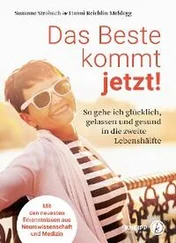Ein weiteres Problem der Introspektion war, dass die Prozesse als Reaktion auf eine Reizpräsentation sehr einfach sein können. Sie können deshalb extrem schnell ablaufen und kurzlebig sein und somit nicht auf einem Niveau ablaufen, das für den bewussten Zugriff durch Introspektion zugänglich ist. Nehmen wir als illustratives Beispiel ein Experiment, in dem ein Licht präsentiert wird und die Versuchspersonen möglichst schnell eine Taste betätigen müssen, wenn sie dieses Licht detektieren. In jungen Erwachsenen werden in Computerexperimenten dieser Art Reaktionszeiten von etwa 200 ms gemessen. Die ersten etwa 100 ms werden für die sensorische Übertragung des durch den visuellen Lichtreiz ausgelösten Signals von der Retina in die verschiedenen Gehirnareale benötigt. Die verbleibende Zeit wird für die Aktivierung eines motorischen Programms benötigt, d. h. für die Übertragung dieses Programms zu den Effektoren (z. B. den Fingern) und für die Ausführung des Programms. Die meisten sensorischen und motorischen Übertragungsprozesse in diesem Experiment ermöglichen keinen bewussten Zugriff, der eine Introspektion erlaubt. Diese Argumente lösten eine Debatte um die Gültigkeit der Befunde mit der Methode der Introspektion aus und führten zu einer Ablösung dieser Methode.
Dann, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, entwickelte sich die Psychologie vornehmlich in den USA (sowie durch den russischen Forscher Ivan P. Pawlow) ziemlich »kognitionslos«. Die Strömung des Behaviorismus reagierte auf die Nachteile der Introspektionsmethode und die Schwierigkeiten im Zugriff auf mentale Prozesse, indem sie diese Prozesse als Gegenstand der psychologischen Forschung ausklammerte (Watson, 1913). Nach Ansicht des Behaviorismus sollte sich Psychologie ausschließlich mit von außen beobachtbaren objektiven Daten befassen, ohne dabei schlecht zu erfassende und zu definierende Konzepte, wie Gedächtnis oder Aufmerksamkeit, zu verwenden. Diese Phase wird deshalb als cognitive winter bezeichnet. Tiere ersetzten in den Laboren den Menschen als Gegenstand der Untersuchungen und die Forschung wurde in dieser Zeit vornehmlich auf die Bereiche Lernen und Motivation ausgerichtet. Diese Bereiche sind eher behavioristisch als kognitiv geprägt. In diesem Buch wird auf diese Bereiche deshalb nur begrenzt eingegangen. Neben der auf wenige Bereiche sehr eingegrenzten Forschungstätigkeit und dem Ignorieren des für die Psychologie Wesentlichen, nämlich die mentalen Prozesse des Erlebens und Verhaltens, ist theoretisch nur wenig vom Behaviorismus bezüglich der Kognitiven Psychologie übriggeblieben; auch das strikte »anti-kognitive« Vorgehen als Reaktion auf die Introspektion ist nicht mehr vollständig nachvollziehbar (Anderson, 2013). Was bis heute vom Behaviorismus erhalten ist, ist vielleicht seine methodische Vorgehensweise mit systematischen und strikten Verfahren und Prinzipien bei experimentellen Untersuchungen, die prinzipiell in kognitionspsychologischer Forschung angewendet wird.
Allerdings herrschte der cognitive winter in Europa nicht flächendeckend, sondern mancherorts war Kognitive Psychologie ein reges Forschungsthema: Der Russe Alexander Luria untersuchte Störungen im Verständnis und der Produktion von Sprache (Aphasien), in der Schweiz formulierte Jean Piaget seine generelle Theorie der kognitiven Entwicklung (z. B. die Entwicklung des Mengen- oder Zahlbegriffs im Kindesalter), in Deutschland beschäftigte sich die Gestaltpsychologie mit Wahrnehmung (  Kap. 2.2.2) sowie Problemlösung und speziell die Würzburger Schule untersuchte kognitive Prozesse, die dem Denken zugrunde liegen. Leider sind viele der letztgenannten Forschungsaktivitäten durch den Nationalsozialismus verloren gegangen, was beweist, dass Entwicklungen in der Kognitiven Psychologie nicht allein durch wissenschaftliche Kriterien bestimmt werden.
Kap. 2.2.2) sowie Problemlösung und speziell die Würzburger Schule untersuchte kognitive Prozesse, die dem Denken zugrunde liegen. Leider sind viele der letztgenannten Forschungsaktivitäten durch den Nationalsozialismus verloren gegangen, was beweist, dass Entwicklungen in der Kognitiven Psychologie nicht allein durch wissenschaftliche Kriterien bestimmt werden.
Die Kognitive Psychologie in ihrer heutigen Form begann sich zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu entwickeln. Drei Faktoren sind für diese neuere Entwicklung verantwortlich:
1. Vor allem während des Zweiten Weltkrieges war es notwendig, Erleben und Verhalten im Umgang mit technisch komplexen Systemen zu erklären und vorherzusagen. Man war bestrebt, Piloten und Flugzeuge effizienter einsetzen zu können und Flugzeugabstürze durch menschliche Fehler zu vermeiden. In diesem Fokus entstanden beispielsweise Informationsverarbeitungstheorien der Aufmerksamkeit durch Donald Broadbent (  Kap. 3.1.2). Solche Informationsverarbeitungstheorien haben das Ziel, kognitive Prozesse in eine Reihe von Einzelschritten zu zerlegen und sie damit zu analysieren; der Behaviorismus bot für derartige praxisbezogene Fragen keine Hilfe an. Dieser Ansatz der Informationsverarbeitungstheorien wurde nach dem Krieg von kognitionspsychologischen Laboren übernommen und ist bis heute vorherrschend in der Kognitiven Psychologie.
Kap. 3.1.2). Solche Informationsverarbeitungstheorien haben das Ziel, kognitive Prozesse in eine Reihe von Einzelschritten zu zerlegen und sie damit zu analysieren; der Behaviorismus bot für derartige praxisbezogene Fragen keine Hilfe an. Dieser Ansatz der Informationsverarbeitungstheorien wurde nach dem Krieg von kognitionspsychologischen Laboren übernommen und ist bis heute vorherrschend in der Kognitiven Psychologie.
2. Die Auseinandersetzung mit »kognitiven« Themen bestimmte die Entwicklung der Kognitiven Psychologie. Das bedeutet unter anderem, dass die Anwendung von Fortschritten in den Computerwissenschaften um Allen Newell und Herbert Simon (Newell & Simon, 1972) auf Künstliche Intelligenz dazu geführt hat, die Entwicklung dieser Intelligenz voranzubringen. Fortschritte in der Computertechnik ermöglichen es, menschliche Kognition zu simulieren (  Kap. 1.1). Die heutige Laborforschung und das Erstellen systematischer Untersuchungsbedingungen mit den daraus resultierenden Ergebnissen sind nicht ohne diese Technik denkbar (
Kap. 1.1). Die heutige Laborforschung und das Erstellen systematischer Untersuchungsbedingungen mit den daraus resultierenden Ergebnissen sind nicht ohne diese Technik denkbar (  Kap. 10). Des Weiteren führte die Linguistik und die kognitive Sprachwissenschaft um Noam Chomsky (Chomsky, 1959) die Erforschung der Sprache als Thema in die Kognitive Psychologie ein. Chomsky erkannte, dass komplexe Phänomene, wie Sprachverständnis und -produktion, nicht durch behavioristische Ansätze zu erklären waren.
Kap. 10). Des Weiteren führte die Linguistik und die kognitive Sprachwissenschaft um Noam Chomsky (Chomsky, 1959) die Erforschung der Sprache als Thema in die Kognitive Psychologie ein. Chomsky erkannte, dass komplexe Phänomene, wie Sprachverständnis und -produktion, nicht durch behavioristische Ansätze zu erklären waren.
3. Die neuere Entwicklung der Kognitiven Psychologie ist institutionell. Dieser Faktor lässt sich konkret an das Jahr 1956 und speziell an zwei Konferenzen sowie verschiedenen Publikationen festmachen (Gobet, Chassy & Bilalic, 2011). Die zwei Konferenzen »Symposium of Information Theory« am Massachusetts Institute of Technology und »Dartmouth Conference« beschäftigten sich mit klassischen kognitiven Themen wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Im Verlauf dieser Konferenzen wurde klar, dass der Behaviorismus für diese wie auch andere kognitive Themen keine ausreichenden Erklärungsansätze bot. Außerdem wurden im Jahr 1956 zwei der wohl einflussreichsten frühen kognitiven Publikationen veröffentlicht. Bruner, Goodnow und Austin (1956) haben systematisch die Entstehung von Konzepten im Gedächtnis untersucht. Schon die Verwendung von Begriffen wie Konzepte und Gedächtnis war im Behaviorismus nicht zulässig. George Miller (1956) unternahm außerdem den Versuch, die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses und eine Einheit für die Messung dieser Kapazität zu bestimmen (  Kap. 5.3).
Kap. 5.3).
Heute hat sich die Kognitive Psychologie zu einer sehr dynamischen, aktiven und internationalen Disziplin entwickelt. Ihre unterschiedlichen Fokusse haben sich durch verschiedene Konferenzen und Fachjournale (z. B. Memory & Cognition; Attention, Perception, & Psychophysics) institutionalisiert. Die Kognitive Psychologie ist heute vor allem durch den spezifischen kognitiven Bereich gekennzeichnet, der untersucht wird (z. B. Wahrnehmungspsychologie, Aufmerksamkeitspsychologie).
Читать дальше
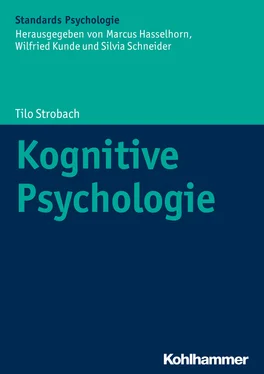
 Kap. 2.2.2) sowie Problemlösung und speziell die Würzburger Schule untersuchte kognitive Prozesse, die dem Denken zugrunde liegen. Leider sind viele der letztgenannten Forschungsaktivitäten durch den Nationalsozialismus verloren gegangen, was beweist, dass Entwicklungen in der Kognitiven Psychologie nicht allein durch wissenschaftliche Kriterien bestimmt werden.
Kap. 2.2.2) sowie Problemlösung und speziell die Würzburger Schule untersuchte kognitive Prozesse, die dem Denken zugrunde liegen. Leider sind viele der letztgenannten Forschungsaktivitäten durch den Nationalsozialismus verloren gegangen, was beweist, dass Entwicklungen in der Kognitiven Psychologie nicht allein durch wissenschaftliche Kriterien bestimmt werden.