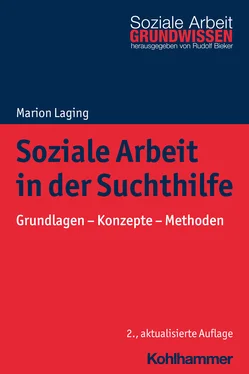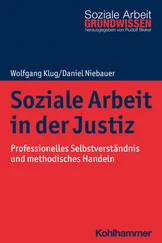Der Rationalisierungsdruck auf die Individuen bewirkt zum einen die Entwicklung einer »Selbstzwangsapparatur«, das heißt, dass externe Kontrollen nach innen verlagert werden. Damit wird auch Trunkenheit als ein Mangel an Selbstdisziplin und als Verlust der Selbstkontrolle erfahrbar. Andererseits wachsen mit der Verinnerlichung von Zwängen auch spezifische Ängste und innere Spannungen an, die zumindest punktuell ein Ventil suchen: Wird im Mittelalter getrunken, weil die Affekte ungehemmt sind, so wird in der Neuzeit getrunken, um sie zu enthemmen. War das mittelalterliche Gelage eine gemeinschaftliche magische Praxis und soziale Pflicht für Männer, so wird mit der Durchsetzung disziplinarischer Zwänge und Tugenden und individualisierter Handlungsorientierungen der Rausch einerseits asozial und zu einer Pflichtverletzung, andererseits erhält er die Funktion der individuellen Entspannung (Groenemeyer und Laging 2012: 221–228).
Zugleich kam es – auch durch die zunehmenden Verfügbarkeiten hochprozentiger Alkoholika durch die Verbreitung preiswerter Destillationsverfahren – zu sehr breiten alkoholassoziierten Verelendungen in proletarischen städtischen Schichten in teilweise epidemischen Ausmaßen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen konnte Benjamin Rush (1745–1813) erstmalig eine Krankheitskonzeption übermäßigen Alkoholkonsums entwickeln, die als Vorläufer moderner Alkoholismuskonzeptionen gilt (Groenemeyer und Laging 2012: 228). Diese Konzeptionen können zudem als Prototyp für Suchtkonzeptionen allgemein (unabhängig von der Substanz) gelten und werden in Kapitel 1 »Sucht – eine Erkrankung wie jede andere auch?« differenzierter diskutiert.
3.6.2 Substanz und Konsumformen
Alkohol (C2H5OH) ist eine klare, farblose Flüssigkeit, die bei der Vergärung von Zucker entsteht. Alle zuckerhaltigen Nahrungsmittel können dementsprechend als Ausgangsstoff verwendet werden. Zur Alkoholgewinnung können Weintrauben, Getreide, Früchte, Zuckerrohr, Mais oder Kartoffeln verwendet werden.
Der Alkoholgehalt unterscheidet sich stark je nach Art des Getränks. Der Alkoholgehalt von Bier liegt zwischen 4 und 8 Prozent, der von Rotwein zwischen 11,5 und 13 Prozent und hochprozentige Getränke wie z. B. Rum erreichen einen Alkoholgehalt von 45 und mehr Volumenprozenten.
Dieser weitaus höhere Alkoholgehalt kann nur durch Destillationsverfahren erreicht werden. Hierbei wird der Alkohol in speziellen Vorrichtungen erhitzt. Der entstehende Dampf wird aufgefangen und verflüssigt sich bei der Abkühlung wieder.
Alkohol gilt generell als dämpfende Droge, auch wenn das Wirkungsspektrum sehr breit und abhängig von der Dosis ist. Wirkt Alkohol in kleinen Mengen eher aktivierend, entspannend und geselligkeitsfördernd, so tritt bei stärkerer Dosierung die dämpfende und zum Teil die bewusstseinsändernde Wirkung hervor (Soyka et al. 2008: 22f). Dabei kann der Rausch in drei Stadien eingeteilt werden, in denen dann unterschiedliche – auch unerwünschte – Wirkungen zum Tragen kommen:
1. Bei einem leichten Rausch kommt es zu einer verminderten psychomotorischen Leistungsfähigkeit, Enthemmung, vermehrtem Rede- und Tätigkeitsdrang.
2. Bei einem mittleren Rausch kann es zu Euphorie, aber auch zu aggressiver Gereiztheit, verminderter Selbstkritik und explosiven Reaktionsweisen kommen.
3. Ein schwerer Rausch führt zu Bewusstseinsstörungen, Desorientierung, Angst, Erregung, Schwindel, Störung der Bewegungsabläufe, Sprechstörungen, alkoholischem Koma, Tod durch zentral-atemdepressive Alkoholwirkung oder Erstickung (Grosshans et al. 2016: 94f; Soyka et al. 2008: 163f).
3.6.4 Risiken und Folgeschäden
Bei unverträglicher Dosierung kann Alkohol zu Aufdringlichkeiten, überschießender Aggression oder – umgekehrt – zu sozialem Rückzug und weinerlichem Selbstmitleid führen. Betrunkensein und soziale Enthemmung sind nicht selten mit Selbstentblößung im wörtlichen wie im übertragenden Sinne verbunden (Kuntz 2007: 111). Die organischen Langzeitfolgen sind erheblich und betreffen Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen-Darmtrakt, Herzkranzgefäße und das Muskelsystem. Zu den wichtigsten neurologischen Störungen gehören allgemeine Hirnveränderungen, Wernicke-Korsakow-Syndrom, Alkoholische Kleinhirnatrophie und Schlaganfall (Soyka et al. 2008: 175–218). Die starke Verbreitung der Alkoholabhängigkeit in Deutschland ( 
Kap. 4
) weist auf die Gefährdungen, die von der Droge Alkohol ausgehen.
3.7 Heroin
3.7.1 Hintergrund
Heroin ist ein teilsynthetisches Opiat (Diacetylmorphin), das auf der Basis eines Inhaltsstoffes der Opiumpflanze, nämlich des Morphin, in verschiedenen chemischen Prozeduren hergestellt wird (Scherbaum 2017: 142). Als Ausgangsstoff der Heroin-Herstellung dient der eingetrocknete Milchsaft des einjährigen Schlafmohns (Geschwinde 2013: 322). Zurzeit stammt mehr als 90 Prozent des weltweit gehandelten Heroins aus Afghanistan. Weitere Länder in der Heroinproduktion waren oder sind die Türkei, Mexiko, Laos, Thailand, Myanmar, Iran, Pakistan sowie Länder in Mittelamerika (Scherbaum 2017: 93). Die Produktion erfolgt in modernen, aber auch in äußerst primitiv eingerichteten sogenannten »Badewannen-Labors« (Geschwinde 2013: 325). Produktion und Vertrieb sind fest in der Hand des weltweit operierenden organisierten Verbrechens (Kuntz 2007: 140), oftmals in enger Verbindung mit illegalem Waffenhandel und der Finanzierung des organisierten Terrorismus (Geschwinde 2013: 338).
Diacetylmorphin wurde unter dem Namen Heroin erstmalig im Jahr 1898 als Medikament gegen verschiedene Krankheiten, insbesondere bei Atemwegserkrankungen, durch den deutschen Pharmakonzern Bayer auf den Markt gebracht. Nachdem das Suchtpotenzial von Heroin erkannt wurde, verlor es seine medizinische Bedeutsamkeit (Kuntz 2007: 140).
In der damaligen Bundesrepublik Deutschland tauchte Heroin im Jahr 1968 über hier stationierte US-Soldaten wieder auf (Geschwinde 2013: 332) und verbreitete sich rasch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Geschwinde 2013: 348). Heute ist die Zahl der jährlich neu an Heroinabhängigkeit Erkrankten in Deutschland seit vielen Jahren konstant, eventuell sogar leicht rückläufig (Scherbaum 2017: 93).
3.7.2 Substanz und Konsumformen
Reines Heroin ist weiß, kristallin, geruchlos, es schmeckt bitter und unangenehm. Straßenheroin gibt es in unterschiedlichen Reinheitsgraden und als verschiedene Granulate, von braunem bis zu reinerem weißen Heroin.
Heroin kann oral, intranasal oder intravenös konsumiert werden, wobei die orale Anwendungsart kaum eine Rolle spielt. Bei inhalativem Konsum sind die Risiken für die Gesundheit im Vergleich zum intravenösen Konsum etwas geringer. Die stärkste Wirkung entfaltet Heroin nach intravenöser Injektion (Scherbaum 2017: 93f).
Charakteristisch für die Kurzzeitwirkung von Heroin ist der »flash«, »kick« oder »hit«, das heißt die unmittelbar nach der Injektion und dem Lösen der Abbindung erfolgende schlagartige Anflutung des Wirkstoffes. Es setzt eine überwältigende Euphorie ein, ein intensives Wohlbefinden, verbunden mit Wärme, Wohlbehagen, vollständiger Sorglosigkeit. Dieser akute Intoxikationszustand kann einige Minuten anhalten (Geschwinde 2013: 375; Scherbaum 2017: 95). Danach setzt ein länger anhaltender Zustand von gleichgültiger Zufriedenheit ein, ein träumerisches Versinken sowie das Gefühl, über den Dingen zu stehen (Kuntz 2007: 141; Scherbaum 2017:95; Geschwinde 2013: 374ff).
3.7.4 Risiken und Folgeschäden
Читать дальше