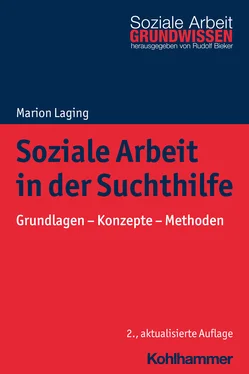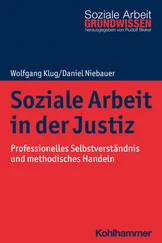3.2.2 Substanz und Konsumformen
Die Cannabispflanze ist eine krautartige Pflanze mit uneinheitlicher botanischer Klassifikation. Die psychoaktive Wirkung wird hauptsächlich von Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) erzeugt (Scherbaum 2017: 39). Die Cannabispflanze wird zu folgenden Cannabis-Produkten verarbeitet:
• Cannabis-Kraut bzw. Blütenstände (Marihuana),
• Cannabis-Harz (Haschisch),
• Cannabis-Konzentrat (Haschischöl) (Geschwinde 2013: 4; Scherbaum 2017: 43).
Der THC-Gehalt von Marihuana und Haschisch variiert erheblich (zwischen 2 und 20 Prozent), Cannabisöl kann einen THC-Gehalt von bis zu 80 Prozent aufweisen (Scherbaum 2017: 43). Durch spezielle Züchtungen wird versucht, eine Erhöhung des THC-Gehalts von Marihuana und Haschisch bis zu einem Wirkstoffgehalt von 30 Prozent zu erreichen. Der als Nutzpflanze in Deutschland zugelassene Faserhanf darf demgegenüber eine THC-Konzentration von nur maximal 0,2 Prozent aufweisen (Scherbaum 2017: 39).
Cannabisprodukte werden überwiegend als »Joint« oder in oft sehr aufwändig gestalteten Pfeifen geraucht. Aber auch oral, z. B. in Keksen oder im Tee, kann Haschisch zu sich genommen werden (Scherbaum 2017: 45).
In den letzten Jahren sind vermehrt synthetische Cannabinoide aufgekommen. Sie sind wie THC an den Rezeptoren des körpereigenen Cannabinoidsystems wirksam und verursachen cannabisartige psychotrope Wirkungen, die aber teilweise sehr viel intensiver ausfallen als bei Marihuana oder Haschisch. Wird die chemische Zusammensetzung der synthetischen Cannabinoide identifiziert, werden auch diese dem Betäubungsmittelgesetz (BTMG) unterstellt. Jedoch kommen immer wieder neue synthetische Cannabinoide mit geringfügig veränderter chemischer Zusammensetzung auf den Markt, die solange legal sind, bis auch sie den Prozess der chemischen Identifizierung und BTMG-Unterstellung durchlaufen haben (Geschwinde 2013: 88–96; Scherbaum 2017: 42f).
Cannabis bewirkt eine Veränderung der Wahrnehmung und des Erlebens. Der Rausch lässt sich typischerweise in drei Phasen untergliedern: 1) Unruhe, 2) Hochstimmung, 3) entspannte, ausgeglichene und gelassene Stimmung, Antriebsminderung, körperliches Wohlbefinden. THC ist ein mildes Halluzinogen, erst bei höheren Dosen treten Halluzinationen, Wahnerleben, schwerwiegende formale Denkstörungen sowie Ich-Störungen (z. B. Depersonalisation, Erleben von Fremdheit des eigenen Körpers) auf.
Typische Rauscherlebnisse nach dem Konsum von Cannabis
• Gehobene Stimmung, Euphorie, Heiterkeit;
• verminderter Antrieb, Passivität, Apathie, Lethargie;
• Denkstörungen: bruchstückhaftes Denken, Herabsetzung der gedanklichen Speicherungsfähigkeit, Verlust der Erlebniskontinuität, Ordnung nach assoziativen Gesichtspunkten, ideenflüchtiges Denken;
• Störungen der Konzentration und Aufmerksamkeit: erhöhte Ablenkbarkeit, abnorme Reizoffenheit (Störungen des Kurzzeitgedächtnisses), abnorme Fokussierung der Wahrnehmung, Ausrichtung auf irrelevante Nebenreize;
• Verlust des Zeitgefühls und Evidenzerlebnisse; das Gefühl, neue Einsichten (vergleichbar mit mystischen religiösen Erlebnissen), das Gefühl des Verschmelzens des Selbst und der Welt oder das Gefühl, Visionen zu haben;
• unangenehme oder überwältigende Rauscherlebnisse bei sehr hoher Dosierung (Täschner 2005: 111–124; Geschwinde 2013: 42; Scherbaum 2017: 46f).
3.2.4 Risiken und Folgeschäden
Im Vergleich zum Trinkalkohol oder zu Heroin sind Cannabis-Produkte relativ ungiftig, da bereits geringe THC-Mengen die erwünschte Wirkung hervorbringen und die akute Toxizität bei der biogenen Form der Droge relativ gering ist. Die Gefahr einer Vergiftung bzw. Überdosierung besteht demnach kaum. Unter den akuten Risiken sind Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und andere Unfallgefahren zu nennen (Geschwinde 2013: 39). In seltenen Fällen und bei hohen Dosen kann es zu Panikreaktionen, paranoiden Zuständen und psychotischen Symptomen kommen (Hoch et al. 2012: 129). Alle weiteren Risiken und Schäden können nicht über den Substanzkonsum an sich, sondern nur im Zusammenhang des jeweiligen Konsummusters, der Lebenslagen und der psychischen Verfasstheit der Konsumenten und Konsumentinnen sinnvoll betrachtet werden.
So ergeben sich hinsichtlich der psychischen Wirkungen offenbar nur als relativ gering einzustufende Gefahren für ältere und bereits in ihrer Persönlichkeit gefestigte Cannabis-Konsumenten – soweit kein exzessiver Cannabis-Missbrauch erfolgt und Haschisch bzw. Marihuana eher die Funktion von »recreational drugs« bzw. »Freizeitdrogen« haben (Geschwinde 2013: 74).
Wird ein regelmäßiger Konsum im Jugendalter aufgenommen, besteht die Gefahr, dass alterstypische Entwicklungsaufgaben (z. B. Erprobung intimer Partnerschaften, Schul- und Berufsausbildung) nicht mehr bewältigt werden können. In diesem Zusammenhang steht das sogenannte amotivationale Syndromm, das mit dem Witz »Kiffen macht gleichgültig? – Mir doch egal« Eingang in das Alltagswissen gefunden hat. Das amotivationale Syndrom wird vor allem bei langanhaltendem Konsum beobachtet. Es bedeutet, dass die Konsumenten und Konsumentinnen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in ihrem Antrieb eingeschränkt sind, Interesse an Hobbies und/oder an schulischen/beruflichen Entwicklungen verlieren und die Fähigkeit, spontan und schnell Entscheidungen treffen zu können, stark eingeschränkt ist (Scherbaum 2017: 48). Anhand dieser Merkmale hat die WHO eine spezifische Abhängigkeit vom Cannabis-Typ im ICD-10 klassifiziert ( 
Kap. 11
). Die Symptome werden aber oftmals von den Betroffenen selbst nicht als quälend, sondern als Ausdruck des eigenen Lebensstils beschrieben (Geschwinde 2013: 77). Andere bewerten das amotivationale Syndrom als Folge der Dauerintoxikation, so dass es nach der Entgiftung behoben sei (Scherbaum 2017: 48).
Cannabisabhängigkeit ist unbestritten eine äußerst schwerwiegende Folge und zeigt sich – wie andere Abhängigkeiten auch – in einem heftigen Suchtmittelverlangen, Vernachlässigung üblicher Aufgaben im privaten wie im beruflichen Leben, aber auch durch Symptome wie Toleranzbildung und Auftreten von Entzugssymptomen. Typische Entzugssymptome sind innere Unruhe, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Hitze- oder Kälteschauer sowie verminderter oder gesteigerter Appetit. Die psychischen Beschwerden sind oft so stark, dass die Entwöhnung nicht selbstständig bewältigt werden kann. Demgegenüber ist die körperliche Entzugssymptomatik milder als beim Opiat- oder Alkoholentzug (Scherbaum 2017: 48f, 76; Geschwinde 2013: 76).
Etwa 80 Prozent der Cannabis-Abhängigen weisen komorbide psychische Störungen wie etwa depressive Störungen oder Angsterkrankungen auf. Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung konsumieren sehr viel häufiger als die allgemeine Bevölkerung. Zudem verwenden offenbar auch Konsumenten und Konsumentinnen mit schweren Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, wie beispielsweise dem Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS), in Form einer Selbstmedikation Cannabis-Produkte zur Affekt- und Impulsregulierung (Geschwinde 2013: 78; Hoch et al. 2012: 129f).
Cannabiskonsum kann bei manchen Personen eine drogeninduzierte Psychose auslösen, die einen eigengesetzlichen Verlauf nehmen kann, auch wenn inzwischen eine Cannabisabstinenz erreicht wurde. Cannabiskonsum scheint ein eigenständiger Risikofaktor im Zusammenhang mit anderen Risikofaktoren für die Entwicklung einer schizophrenen Psychose zu sein (Scherbaum 2017: 49f; Geschwinde 2013: 42; Reichel und Zilker 2009: 92), dies aber nur in äußerst seltenen Fällen (Täschner 2005: 128).
Читать дальше