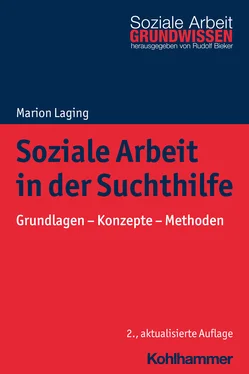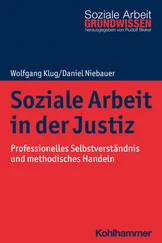Kognitive Funktionen sind während des Rausches beeinträchtigt (s. o.). Es finden sich aber auch kognitive Defizite in den Bereichen von Aufmerksamkeit, Konzentration und Merkfähigkeit bei regelmäßigem Konsum. Neuere Studienzeigen, dass eine Intelligenzminderung auch noch nach längerer Abstinenz von Cannabis feststellbar ist (Scherbaum 2017: 50).
Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass die Wirkungen auf jugendliche Konsumenten und Konsumentinnen sehr viel ausgeprägter und die Risiken einer Abhängigkeitsentwicklung besonders hoch sind, wenn bereits im Jugendalter mit regelmäßigem Konsum begonnen wird (Scherbaum 2017:49; Geschwinde 2013: 78).
Seit ca. 15 Jahren werden die mit dem Cannabiskonsum verbundenen Gesundheitsrisiken zunehmend gravierender eingestuft. Dies hängt damit zusammen, dass sich riskantere Konsummuster entwickeln, der THC-Gehalt der Cannabisprodukte sich kontinuierlich erhöht und die Konsumentenkreise sich ausweiten. Dementsprechend verliert der Typus des selbstidealisierenden »unkonventionellen Freizeitkiffers« an Bedeutung (Geschwinde 2013: 75). Zudem korrespondieren, wie es bislang meist der Fall war, Cannabiskonsum und eine liberale Einstellung nicht mehr unbedingt miteinander. Konsumenten und Konsumentinnen sind heute vielmehr auch in rechtsextremen und gewaltgeneigten Gruppen anzutreffen (ebenda).
3.3 LSD
3.3.1 Hintergrund
LSD (Lysergsäurediethylamid) wird gewöhnlich halbsynthetisch aus dem Mutterkornpilz gewonnen (Geschwinde 2013: 97). Es ist das am stärksten wirksame Halluzinogen (Scherbaum 2017: 126; Geschwinde 2013: 110). Auf der Suche nach Medikamenten gegen Migräne und gegen die Parkinson’sche Erkrankung wurde LSD erstmals bei der Firma Sandoz in Basel im Jahr 1938 durch Dr. Hofmann synthetisiert (Scherbaum 2017: 126; Geschwinde 2013: 99). Die psychotropen Wirkungen wurden jedoch erst im Jahr 1943 durch Zufall entdeckt, als Sandoz-Mitarbeiter Dr. Hofmann versehentlich LSD zu sich nahm und es bei diesem ersten ›Trip‹ zu kaleidoskopartig verändernden bunten Halluzinationen und einer Verwandlung akustischer Wahrnehmungen in optische Empfindungen kam (Geschwinde 2013: 100; Scherbaum 2017: 126f).
Im Jahr 1949 wurde LSD durch die Firma Sandoz in den USA eingeführt. Man erhoffte sich zum einen durch die Herstellung von »experimentellen Psychosen« und »Modellpsychosen« nähere Erkenntnisse über die Entstehung der Schizophrenie, zum anderen wurde LSD im Rahmen psychoanalytisch orientierter Psychotherapie eingesetzt (Geschwinde 2013:100; Scherbaum 2017: 127). Zu den Grundgedanken solcher psychotherapeutischen Versuche gehörte, dass die Rauscherlebnisse ähnlich wie ein Traum etwas über den Berauschten erfahrbar machen und so einen Zugang zu den unbewussten Konflikten eröffnen (Scherbaum 2017: 127; Geschwinde 2013: 100). Diese Hoffnungen erfüllten sich aber im Wesentlichen nicht, so dass sich der Einsatz in den 1960er Jahren insbesondere in der Psychoanalyse deutlich verringerte.
Danach gab es immer wieder sporadische Ansätze, LSD sowie Ecstasy und Psilocybin therapeutisch zu nutzen. Heute wird der Einsatz von LSD beim sogenannten Clusterkopfschmerz sowie in der Psychotherapie von Krebspatienten im Endstadium diskutiert (Scherbaum 2017: 127; Geschwinde 2013: 101).
Parallel zur therapeutischen Nutzung setzte in den 1950er Jahren in Nordamerika ein starkes Interesse von Armee und CIA an LSD unter dem Aspekt einer »psycho-chemischen Kriegsführung« ein (Psycho-Kampfstoffe). Es stellte sich aber heraus, dass eine Beherrschbarkeit des Wirkstoffeinsatzes generell nicht erreichbar war (Geschwinde 2013: 101f).
Ausgehend von der LSD-Psychotherapie propagierte die »Psychedelische Bewegung« ab 1962 in den USA den LSD-Konsum als Mittel zu einer allgemeinen, unspezifischen »Bewusstseinserweiterung«. Promotor der Bewegung war u. a. Timothy Leary, bis zu seiner Entlassung 1966 Professor für Psychologie an der Harvard-University, der zum »Drogenapostel« wurde, und der Religionsphilosoph Alan Watts, der LSD den sakralen Drogen der amerikanischen Ureinwohner gleichstellte (Geschwinde 2013: 102). »Turn on, tune in, drop out« wurde ein geflügeltes Wort der Hippie- und Flower-Power-Bewegung der 1960er Jahre. Überall machten »head shops« für »acid head’s« (»Säureköpfe«, da LSD auch als »acid« bezeichnet wird) auf. Hier konnten die Mittel zum Entfliehen aus der rational-materialistischen Umwelt erworben werden – einer Umwelt, die sich als unfähig zeigte, sich aus den Verstrickungen eines zunehmenden Engagements im Vietnam-Krieg zu lösen. Häufig wurden daher die sich bildende Drogensubkultur und die politische Protestbewegung (insbesondere gegen den Vietnam-Krieg) in dieser Zeit gleichgesetzt (»the only hope is dope«) (Geschwinde 2013: 102).
Mit der Ausbreitung der Substanz häuften sich aber auch unerwünschte Zwischenfälle, z. B. Angstzustände bei psychotischem Erleben. 1967 wurde LSD in den USA verboten (Scherbaum 2017: 127f). In den 1980er Jahren erfuhr LSD eine neue Popularitätswelle. Im Kontext der Entwicklung der Partyszene wurde LSD nun weniger als Hilfsmittel genutzt, um innere Erkenntnisse zu gewinnen, sondern – eher niedrig dosiert – als anregendes Mittel für die Intensivierung von Sinneswahrnehmungen eingesetzt (Scherbaum 2017: 128).
Nachdem in den 1960er und 1970er Jahren im Zeichen relativer materieller Sicherheit in den westlichen Staaten bei gleichzeitig verbreiteter Infragestellung von Autorität ein Bedürfnis nach Beschäftigung vornehmlich mit dem eigenen Erleben und den eigenen Emotionen – ggf. unter Zuhilfenahme von Halluzinogenen – entstanden war, schwächte dieser Trend seit Beginn der 1980er Jahre wieder ab und machte erneut mehr auf die Außenwelt bezogenen Wertvorstellungen Platz. Hiermit dürfte die seitdem zunehmende Bedeutung u. a. von Kokain und Ecstasy als Drogen korrespondieren, die den Kontakt zu den Mitmenschen verbessern und die Leistungsfähigkeit stimulieren sollen. Dem weiterhin bestehenden Bedürfnis einer Reihe Jugendlicher und Heranwachsender nach intensiver Beschäftigung mit dem eigenen Ich bei gleichzeitigem Angebot »letzter Wahrheiten« scheinen seit Ende der 1970er Jahre zu einem nicht unerheblichen Teil – jedenfalls zeitweise – Jugendsekten entgegengekommen zu sein (Geschwinde 2013: 105).
3.3.2 Substanz und Konsumformen
LSD wird in Deutschland nach wie vor gelegentlich »vor Ort«, meist jedoch in Nachbarländern wie den Niederlanden, in »Underground«-Labors in sehr unterschiedlichen Reinheitsgraden hergestellt. Der internationale Handel auf diesem Teilmarkt ist dementsprechend unbedeutend (Geschwinde 2013: 130). LSD wird fast ausschließlich oral konsumiert, z. B. mittels LSD-getränktem und oftmals bunt bedrucktem Löschpapier. Mit den bunten Aufdrucken versuchen die Hersteller, bei den Nutzern und Nutzerinnen einen Wiedererkennungseffekt herzustellen (Scherbaum 2017: 128f).
LSD entfaltet seine stärkste Wirkung nach etwa einer Stunde; die Wirkung ist dabei abhängig von der Dosierung. Zu den eher schwachen Effekten bei niedrigerer Dosierung zählen Euphorie und unkontrolliertes Lachen, Schwierigkeiten bei der Bewegungskoordination und visuelle Psychohalluzinationen. Bei stärkeren Dosierungen bilden die farbigen Psychohalluzinationen eine kaleidoskopartige Landschaft, die ständig in Bewegung bleibt. Der Konsument erlebt eine Aufhebung des Zeit- und Raumgefühls. Die logische Analyse, Aufzeichnungen und Beschreibungen dieser Erlebnisse werden zunehmend schwierig, von den Konsumenten und Konsumentinnen jedoch zum Teil als mystisch bedeutungsvoll oder religiös erleuchtend erlebt. Oftmals können die Halluzinationen nicht mehr von der Realität unterschieden und nicht mehr gesteuert werden. Hierdurch können Panikreaktionen ausgelöst werden, die als ›Horrortrip‹ bekannt sind. Teilweise geht zudem das Ich-Bewusstsein verloren, die Nutzer und Nutzerinnen können sich nicht an die eigene Person oder Identität erinnern (Scherbaum 2017: 130f; Kuntz 2007: 129f; Geschwinde 2013: 112–115). Dabei gilt für LSD ebenso wie für Cannabis und Ecstasy, dass die konkrete Wirkung sich auch immer in Abhängigkeit von der eigenen Erwartungshaltung, Stimmung und bestimmten Umgebungsfaktoren entfaltet (Geschwinde 2013: 115).
Читать дальше