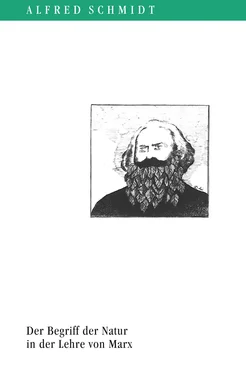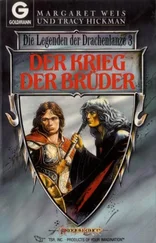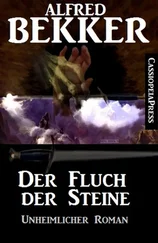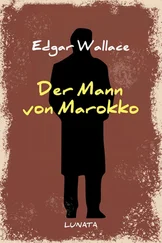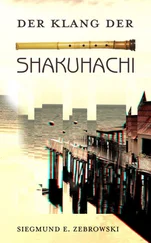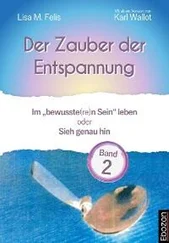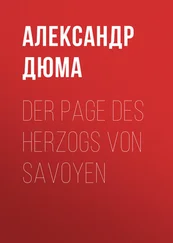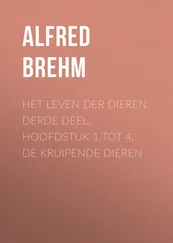Die Naturalform der Ware, das, was Marx ihren Gebrauchswert nennt, tritt in der Analyse des Wertbildungsprozesses nur auf, sofern sie »materielles Substrat, Träger des Tauschwerts« 2ist. Demgegenüber soll hier, wo es primär um das Philosophische an der Marxschen Theorie geht, der Produktionsprozeß vor allem als Gebrauchswerte hervorbringender Arbeitsprozeß in seiner geschichtlichen Bewegung betrachtet werden.
Was den Marxschen Naturbegriff im Ansatz von anderen Naturkonzeptionen unterscheidet, ist sein gesellschaftlich-geschichtlicher Charakter. Marx geht von der Natur aus als »der ersten Quelle aller Arbeitsmittel und -gegenstände« 3, das heißt, er sieht sie von vornherein relativ auf menschliche Tätigkeit. Alle sonstigen Aussagen über Natur, seien sie spekulativer, erkenntnistheoretischer oder naturwissenschaftlicher Art, setzen die Gesamtheit der technologisch-ökonomischen Aneignungsweisen der Menschen, gesellschaftliche Praxis, jeweils schon voraus.
Wie die erscheinende Natur und alles Naturbewußtsein im Laufe der Geschichte immer mehr zu einer Funktion objektiver Prozesse der Gesellschaft herabgesetzt werden, so erweist sich umgekehrt für Marx die Gesellschaft ebensosehr als ein Naturzusammenhang. Nicht nur in dem unmittelbar kritisch gemeinten Sinne, daß die Menschen ihrer eigenen produktiven Kräfte gegenüber der Natur noch immer nicht Herr sind, daß ihnen diese Kräfte als die organisierte, feste Form einer undurchschauten Gesellschaft gegenübertreten, als »zweite Natur«, die ihren Schöpfern ein eigenes Wesen entgegensetzt, sondern darüber hinaus in dem »metaphysischen« Sinne einer Theorie des Weltganzen.
Auch der begriffene und beherrschte Lebensprozeß der Menschen bleibt ein Naturzusammenhang. Unter allen Formen der Produktion ist die menschliche Arbeitskraft »nur die Äußerung einer Naturkraft« 4. In der Arbeit tritt der Mensch »dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber« 5. »Indem er ... auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur.« 6Die Dialektik von Subjekt und Objekt ist für Marx eine Dialektik von Bestandteilen der Natur.
Thesenhaft ließe der Inhalt der vorliegenden Schrift sich bezeichnen als ein Versuch, die wechselseitige Durchdringung von Natur und Gesellschaft, wie sie innerhalb der Natur als der beide Momente umfassenden Realität sich abspielt, in ihren Hauptaspekten darzustellen. Als Quellentexte legt sie das gesamte zugängliche Werk von Marx zugrunde. Sie zieht die Engelsschen Schriften zur Verdeutlichung der Marxschen Position hinzu, soweit sie nicht, gemessen an dieser Position, der Kritik verfallen. Das gilt insbesondere für die Engelssche Fassung des Begriffs der Naturdialektik.
Wo auf die Marxschen Frühschriften eingegangen wird, ist es dem Verfasser mehr darum zu tun, den genetischen Zusammenhang zu bestimmten Motiven des mittleren und reifen Marx herzustellen als um den heute so verbreiteten wie verfehlten Versuch, das eigentlich philosophische Denken von Marx auf das in diesen Texten Gesagte, namentlich auf die Anthropologie der Pariser Manuskripte zu reduzieren. Aus der Überlegung heraus, daß Marx keineswegs da am philosophischsten ist, wo er sich der traditionellen Schulsprache der Philosophen bedient, werden hier in weit höherem Maße, als es sonst bei philosophischen Marxinterpretationen üblich ist, die politischökonomischen Schriften des mittleren und reifen Marx zu Rate gezogen, vor allem der für das Verständnis der Beziehung von Hegel und Marx äußerst wichtige »Rohentwurf« des »Kapitals«, der seither so gut wie unausgewertet geblieben ist.
Ganz abgesehen vom Umfang der zu berücksichtigenden Marxliteratur stellen sich einem Versuch, den Naturbegriff des dialektischen Materialismus darzustellen, erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Bei Marx liegt eine systematische Theorie der Natur, die sich aller spekulativer Implikationen bewußt wäre, nicht vor. Es kam daher darauf an, aus den Hauptphasen der Entwicklung des Marxschen Denkens die oft entlegenen Motive zum Thema zusammenzutragen. Bei der außerordentlichen Verflochtenheit dieser Motive ließen sich gelegentliche Wiederholungen, Überschneidungen, auch Rückverweise nicht ganz vermeiden, so daß die in den einzelnen Kapiteln bzw. Abschnitten behandelten Sachverhalte sich nicht immer völlig mit dem in den Überschriften Angekündigten decken.
1Das Kapital, Bd. I., S. 195.
2A. a. O., S. 194.
3Marx, Kritik des Gothaer Programms, in: Marx/Engels, Ausgew. Schriften, Band II, Berlin 1956, S. 11.
4A. a. O.
5Das Kapital, Bd. I., S. 185.
6A. a. O.
I. Kapitel
Karl Marx und der philosophische
Materialismus
A) Der nicht-ontologische Charakter des Marxschen Materialismus
Die Frage nach dem Marxschen Naturbegriff erweitert sich notwendig zu der nach dem Verhältnis der materialistischen Geschichtsauffassung zum philosophischen Materialismus überhaupt. Mit ihr hat sich die Marxinterpretation nur selten und in wenig befriedigender Weise beschäftigt1. Bei Engels konnte das Problem, ob er auch in einem allgemein-philosophischen Sinn Materialist gewesen sei, gar nicht erst aufkommen. Dazu weisen ihn die Feuerbachschrift, wie der »Anti-Dühring« und die »Dialektik der Natur« zu eindeutig aus. Bei Marx liegen die Dinge etwas anders. Der in seiner Geschichts- und Gesellschaftstheorie enthaltene und von ihr stillschweigend vorausgesetzte philosophisch-materialistische Kern tritt nicht so offen zutage und ist nur schwer herauszupräparieren. Indem der weitaus größte Teil der seitherigen Literatur über Marx mit Grund hervorkehrt, was dessen Materialismus als eine primär an Geschichte und Gesellschaft orientierte Theorie qualitativ von allen philosophiehistorisch aufgetretenen Formen des Materialismus unterscheidet, versäumt er zugleich, diejenigen Momente in Marx gebührend zu berücksichtigen, die ihn selbst mit den antiken Materialisten verbinden. Dabei ist die Frage nach dem Zusammenhang von materialistischer Geschichtsauffassung und philosophischem Materialismus keineswegs zweitrangig oder von bloß terminologischem Interesse. Marx selbst ist sich übrigens dessen bewußt, daß die Bezeichnung seiner Lehre als »materialistisch« mehr bedeutet als eine philosophisch unverbindliche Ausdrucksweise pour épater le bourgeois, daß diese Lehre vielmehr in einem genauen Sinn in die Geschichte der materialistischen Philosophie gehört. So wird in der »Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie« von 1857 als zu bearbeitender Programmpunkt nicht nur die Notwendigkeit angegeben, die These der Abhängigkeit der Staats- und Bewußtseinsformen von den jeweiligen Produktions- und Verkehrsverhältnissen gegenüber »Vorwürfe(n) über Materialismus dieser Auffassung«2 zu verteidigen, sondern es wird auch ausdrücklich das »Verhältnis zum naturalistischen Materialismus«3 genannt, ohne daß Marx je dazu gekommen wäre, dieses Verhältnis explizit zu erörtern.
Zur wirklichen Klärung der Frage, inwiefern eine Theorie, nach der das in letzter Instanz den geschichtlichen Gang der Gesellschaft bestimmende Moment die Art und Weise der Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens der Menschen ist, einen philosophischen Materialismus voraussetzt, ist es erforderlich, sich einige bisher weniger beachtete Aspekte der theoretischen Entwicklung von Marx vor Augen zu führen. Wichtig ist zunächst einmal seine Beurteilung der französischen Aufklärer und der von ihnen bestimmten Strömungen innerhalb des utopischen Sozialismus, wie sie uns in der »Heiligen Familie« begegnet. Hier wird der Materialismus unumwunden als »die Lehre des realen Humanismus und als die logische Basis des Kommunismus«4 bezeichnet. Besonderen Wert legt Marx auf Helvétius, bei dem sich Tendenzen finden, die sensualistische Erkenntnislehre Lockes in eine materialistische Theorie der Gesellschaft zu überführen: »Wenn der Mensch aus der Sinnenwelt und der Erfahrung in der Sinnenwelt alle Kenntnis, Empfindung etc. sich bildet, so kommt es also darauf an, die empirische Welt so einzurichten, daß er das wahrhaft Menschliche in ihr erfährt, sich angewöhnt, daß er sich als Mensch erfährt ... Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muß man die Umstände menschlich bilden ... Wenn der Mensch von Natur gesellschaftlich ist, so entwickelt er seine wahre Natur erst in der Gesellschaft, und man muß die Macht seiner Natur nicht an der Macht des einzelnen Individuums, sondern an der Macht der Gesellschaft messen.«5
Читать дальше