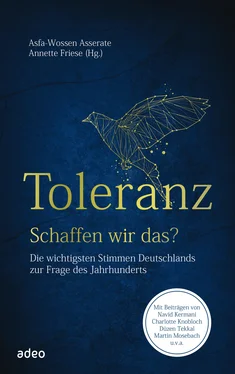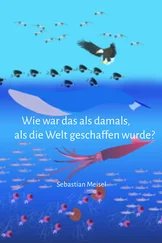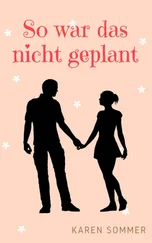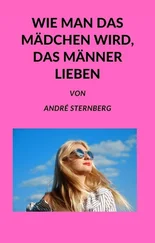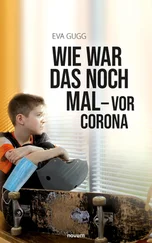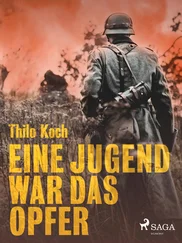Grenzen des Respekts – von kultureller Differenz zu Rahmenbedingungen kultureller Koexistenz
Der Multikulturalismus hat den Euro- und Ethnozentrismus überwunden, aber er hat zugleich auch zu einer Relativierung von Werten geführt. Führt die Politik der Anerkennung in die Sackgasse des Relativismus? Bedeutet Anerkennung des Anderen und Fremden die Aufgabe eigener Grundsätze, Werte, Traditionen? Angesichts der Gefahr der Auflösung eigener Traditionen und Werte kann das Verhältnis zur eigenen Kultur die Gestalt eines fundamentalistischen Bekenntnisses annehmen. Drohender Werteverlust kehrt sich dann um in Wertsteigerung, aus ‚kulturellen‘ Werten werden ‚religiöse‘ Werte, aus Kulturen werden Religionen. Während im Westen das religiöse Bekenntnis in der Folge von Aufklärung und Säkularisierung als Anker der Identität zurückgegangen ist, hat sich dieses Bekenntnis immer stärker auf die ‚westlichen Werte‘ verlagert. Die Religion des Westens ist nicht mehr das Christentum, sondern das Bekenntnis zu universalistischen Werten. Unter diesem Vorzeichen droht ein ‚Kampf der Kulturen‘ bzw. ein Konflikt zwischen der westlichen Kultur und dem Rest der Welt.
Aus dieser Sackgasse führt ein Weg heraus, wenn wir zwischen Kultur und Zivilisation unterscheiden (und dabei diese Begriffe von früheren Bedeutungszuschreibungen lösen). Kultur soll hier für das stehen, was Menschen voneinander unterscheidet. Diese Differenzen haben einen Anspruch darauf, affirmiert, anerkannt und geachtet zu werden, denn sie sind Grundlage für kulturelle Identitäten. Wie Tiere in Biotopen, so leben Menschen in kulturellen Symbolsystemen; sie zu negieren oder zu zerstören hieße, sozialen Zusammenhang, Orientierung und Sinn zu zerstören. Wie die Sprachen sind kulturelle Symbolsysteme kollektive menschliche Schöpfungen; das jeweilige kulturelle Gedächtnis ist in langfristig gewachsenen Strukturen angereichert mit kumulierten Erfahrungen und individuellem Erfindungsgeist. Durch Interaktion mit immer neuen Generationen verändern und erneuern sich kulturelle Traditionen. Kultureller Respekt bezieht sich auf die Anerkennung von Kulturen als grundsätzlich gleichberechtigte Formationen – Jurij Lotman sprach von Semiosphären –, die nicht durch politische oder ökonomische Unterdrückungssysteme wie Kolonialismus oder Globalisierung infrage gestellt werden dürfen.
Der Begriff Zivilisation kann demgegenüber für jene Werte und Praktiken stehen, auf die sich Menschen über ihre kulturellen Bindungen hinaus einigen können. Es handelt sich dabei um universalistische Grundwerte wie körperliche Integrität und Entwicklungsmöglichkeiten der Person unabhängig von Status und Geschlecht, die in der Prämisse der Würde des Menschen verankert sind. Die Entdeckung dieser Prämisse ist kein westliches Monopol; sie kann christlich oder aufklärerisch, aber auch auf der Basis anderer kultureller Semantiken begründet werden. Sie ist deshalb von diesen historischen Ursprüngen zu lösen und als ein Anspruch zu formulieren, den sich unterschiedliche Kulturen und Gesellschaften aneignen und an dem sie sich messen lassen müssen. Dieser Wert gewinnt aber an universaler Bedeutung erst in der Form der Aushandlung und mühsamen Durchsetzung. Diese universalistischen Werte sind kein Eigentum westlicher Kultur, sondern bilden die Rahmenbedingung für die Koexistenz von Kulturen überhaupt. Sie sind das, was Kulturen überschreitet und zugleich verortet, und damit das, was ihr Zusammenleben in einer Welt ermöglicht.
Was ist Gemeinsinn? Die einfachste Definition hat der US-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders gegeben: „Not me. Us!“ Nicht ich, sondern wir. Das war ja auch das Motto unseres Friedenspreises, das wir bei Karl Jaspers gefunden haben: ‚Wahrheit ist, was uns verbindet‘. Egoismus und kalten Wettbewerb, den Ausschluss von Empathie, den strategischen Abbruch von Beziehungen, das Erschweren von Kooperationen und die Zerstörung des Gemeinsinns – das alles gibt es nicht nur auf der Ebene der Individuen. Es gibt inzwischen auch den kollektiven Egoismus der Nationen, die sich gegenseitig überbieten und den Frieden der Welt gefährden. 7In einem Interview hat Salman Rushdie kürzlich festgestellt, dass die drei Länder, in denen er gelebt hat und lebt, alle dieses Modell verkörpern: Narendra Modi mit ‚India first!‘, Boris Johnson mit ‚Britain first!‘ und Donald Trump mit ‚America first!‘ Wir haben es heute mit einem neuen Nationalismus zu tun, der gewalttätige Züge angenommen hat und mit völkischen Parolen und Hass die Gesellschaft spaltet. Es reicht aber nicht, nur über Spaltung und Hass zu sprechen, wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir Gemeinsinn wieder herstellen – auf allen Ebenen: global, in der EU, auf der Ebene der Nation, in den Städten und Schulen.
Menschenrechte und Menschenpflichten
Heute stehen wir am Ende der Entwicklung der friedlichen Erfolgsgeschichte der EU. Das europäische Wir ist gespalten; was vor Kurzem noch als Konsens gelten konnte, stößt heute an klare Grenzen der Zustimmung. Das Modell der Zivilgesellschaft sieht sich inzwischen durch das Gegenmodell einer ‚unzivilen‘ Gesellschaft infrage gestellt. Daran ist nicht zuletzt das Internet beteiligt, in dem die Meinungs freiheit zur Meinungs enthemmung verkommen ist und das kräftig zur Entfesselung von Hass, Hetze und Gewalt beiträgt. Demagogen haben Konjunktur, Hassrhetorik mit Shitstorms und Morddrohungen breiten sich aus, und in Schockstarre erleben wir, wie sich die Gewalt in Form von politischen, rassistischen und antisemitischen Anschlägen ausbreitet.
Auf diese Entwicklung habe ich mit meinem Buch über Menschenrechte und Menschenpflichten reagiert. An die Stelle eines Plädoyers für eine deutsche Leitkultur, die die einen immer schon besitzen und die anderen jetzt schnell lernen müssen, setzte ich dabei die Suche nach einem neuen Gesellschaftsvertrag mit Regeln für ein friedliches Miteinander und dem Respekt gegenüber dem Anderen, also Formen des Umgangs und Anstands, die für alle gelten. Dabei schien es mir wichtig, nicht von dem auszugehen, was uns unterscheidet, sondern von dem, was wir gemeinsam haben und was alle brauchen. Mir ging es um gelebte Demokratie im Alltag und Verhaltensregeln in der Ehe und Familie, aber auch vor der Haustür, auf der Straße, in der Nachbarschaft, den Städten, Gemeinden und Vereinen und natürlich auch in den Schulen.
Während es ganze Bibliotheken über die Menschenrechte gibt, gibt es bisher noch gar nichts zu den Menschenpflichten. Dabei sind sie eine ganz wichtige Ergänzung zu den Menschenrechten und haben seit 2015 auf dem Höhepunkt der Migrationsbewegung nach Europa eine höchst aktuelle Bedeutung gewonnen. Die Menschenrechte enthalten ja den Paragraphen 14, das Recht auf Asyl im Fall politischer Verfolgung, als Grundlage für die massenhafte Ankunft von Geflüchteten an den europäischen Grenzen. Was sich dann aber im Einzelnen an den Grenzen und bei der Ankunft im Zielland abspielte, fand in der Willkommenskultur im Rahmen eines uralten Katalogs von Menschenpflichten statt: Bedürftige bekamen zu essen und zu trinken, sie wurden neu eingekleidet und erhielten ein Dach über dem Kopf. Diese Menschenpflichten sind uns aus den ältesten Texten der Menschheit gut bekannt und reichen in alle Kulturen und Religionen der Welt zurück.
Ein konkretes Beispiel für Menschenpflichten sind die praktischen Lebensweisheiten der alten Ägypter, die Selbstbeherrschung und Bescheidenheit zu zentralen Aspekten ihrer Selbstdarstellung gemacht haben. Man ging in dieser Kultur von einer Ungleichverteilung von Macht und klaren Hierarchien aus. Diejenigen, die in Machtpositionen gelangt waren, hatten deshalb aber auch die Verantwortung, im sozialen Raum das Prinzip Gerechtigkeit (Ma’at) umzusetzen, das zugleich das Prinzip der Weltordnung spiegelt. Diese Ordnung war fragil, denn sie wurde immer wieder durch Gier und Gewalt, Hochmut und persönliche Bereicherung gestört. Die Ungleichheit musste durch gute Taten kompensiert werden, und hier öffneten sich erhebliche Handlungsspielräume. Das folgende Beispiel stammt aus einem Beamtengrab aus der 5. Dynastie aus dem 25. Jahrhundert vor Christus:
Читать дальше