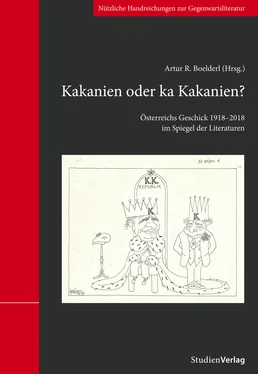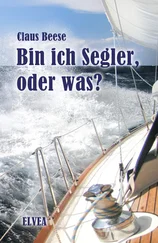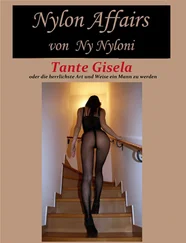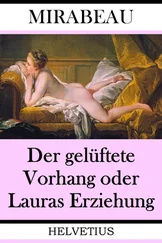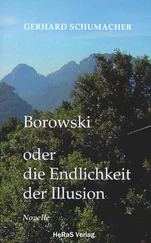Denk- und Verhaltensmuster – „österreichischer Charakter“ und „österreichischer Mensch“
[…] nicht nur die Abneigung gegen den Mitbürger war dort bis zum Gemeinschaftsgefühl gesteigert, sondern es nahm auch das Mißtrauen gegen die eigene Person und deren Schicksal den Charakter tiefer Selbstgewißheit an. Man handelte in diesem Land […] immer anders, als man dachte, oder dachte anders, als man handelte. Unkundige Beobachter haben das für Liebenswürdigkeit oder gar für Schwäche des ihrer Meinung nach österreichischen Charakters gehalten. Aber das war falsch […]. Denn ein Landesbewohner hat mindestens neun Charaktere, einen Berufs-, einen National-, einen Staats-, einen Klassen-, einen geographischen, einen Geschlechts-, einen bewußten, einen unbewußten und vielleicht auch einen privaten Charakter […]. (Musil 2016a, 50)
Hier steht nun der Historiker vollkommen an: Diese Beobachtungen und Wertungen („Liebenswürdigkeit oder gar Schwäche…“) kann man sicher alle irgendwie belegen, aus der Literatur oder den Zeitungen, aber auch genauso widerlegen. Immerhin hat das hier zitierte „Mißtrauen“ doch auch noch viel später literarische Spuren hinterlassen, etwa in der Aufforderung zum Mißtrauen , herausgegeben von Breicha/ Fritsch (1967). 9 Auch die zitierte „Schwäche“ fand ihre literarische Nachfolge, etwa bei Thomas Bernhard (1993). 10 Man muss dabei allerdings bedenken, dass solche Aussagen bei Bernhard vielleicht auch schon bewusste Zitate von Musil’schen Formulierungen gewesen sein können. Der einzige Historiker, der sich – in seiner letzten Arbeit! – mit dieser überaus schwierigen mentalitätsgeschichtlichen Frage auseinandergesetzt hat, war Alphons Lhotsky (wir haben aus diesem Text bereits zitiert).
Historiker meiden im Allgemeinen das glatte Eis einer kollektiven historischen Charakterologie oder Mentalitätsgeschichte, weil man es (erstens) beim Kollektiv „Österreicher“ historisch und gegenwärtig mit einer ungeheuren Menge von Individuen zu tun hat, die (zweitens) in verschiedenen Generations-Kohorten und (drittens) in höchst unterschiedlichen Berufen, familiären, materiellen und Bildungssituationen gelebt haben (und leben). Es ist äußerst fragwürdig, ob dieser höchst unterschiedlichen Ansammlung von Personen aller Altersstufen, von verschiedenem Geschlecht usw. irgendwelche mentale Gemeinsamkeiten eignen sollten. Alphons Lhotsky hat, bei genauerem Hinsehen, den „österreichischen Menschen“ ja auch nicht in der Masse der Bevölkerung gesehen, sondern – Hugo Hassinger zitierend – „einfühlende, verstehende, schmiegsame Kulturmenschen“, „berufene und geschulte Vertreter mitteleuropäischer Vermittlungsarbeit“. Sie sollen, wieder nach Hassinger, unter Staatsmännern, im Adel, in Offiziers- und Beamtenkreisen, in der Geistlichkeit, unter Künstlern, Gelehrten, Kaufleuten und auch in anderen Berufsständen, vorwiegend unter den deutschen, aber auch unter nichtdeutschen Österreichern“ vertreten gewesen sein (Lhotsky 1968, 434). Dieser „österreichische Mensch“ sei, so Lhotsky, das „Ergebnis einer Erziehung besonderer Art, deren Voraussetzung die Übertragung der Repräsentation des Staatsgedankens vom Adel auf die Beamtenschaft und dann auf die Armee gewesen ist“. In diesem Prozess habe die josephinische Geistlichkeit eine wichtige Rolle gespielt, die – nach Joseph II. – „die nächste, die franziszeische Beamtengeneration“ herangezogen habe. Diese Beamten „haben im guten wie oft im minder löblichen Sinne nun auch den ‚österreichischen Menschen‘ möglich gemacht, um nicht zu sagen hervorgebracht“ (ebd.).
Freilich, dieser „österreichische Mensch“, wenn es ihn überhaupt je gegeben hat, war schon 1967, als ihm Alphons Lhotsky jenen ergreifenden Nachruf widmete, tot, und er wird auch niemals wieder zum Leben erweckt werden. Die Aufforderung zum Misstrauen möge als sein Erbe gelten.
Wir wollen unsere fragmentarischen Beobachtungen mit der Frage beenden, ob und in welcher Weise Musils Mann ohne Eigenschaften im Unterricht verwendet werden kann.
Man sollte dies erwägen, schon wegen der sprachlichen und gedanklichen Schulung der Nachkommen, und zweitens wegen der steten Musil’schen Bemühung um die treffendste Beschreibung von Sachverhalten aller Art, freilich immer gebrochen durch seine ironische Darstellungsweise. Nach einer Beobachtung Nicola Mitterers, die sie mir freundlicherweise vor einigen Tagen mündlich mitgeteilt hat, stellte es sich allerdings als untunlich heraus, das Einleitungskapitel (,Woraus bemerkenswerter Weise nichts hervorgeht‘) zu verwenden. Schülerinnen und Schüler reagierten verwundert bis fadisiert auf diesen eigentümlichen Einstieg, der mit einem nur scheinbar präzisen, tatsächlich aber auch schon ironisch gebrochenen und unwahrscheinlichen Wetterbericht beginnt – denn meteorologisch ist gerade diese scheinbar so präzise Darstellung absurd (vgl. Wolf 2011, 266). Freilich fehlt den meisten von uns die nötige physikalische Vorbildung, um diese Absurdität zu erkennen. In den allermeisten Klassen werden wir daher mit dem ersten Kapitel des Mann ohne Eigenschaften kein sehr positives Echo erregen.
Anders das achte, das Kakanien-Kapitel. Es könnte gute Dienste leisten in einer Kooperation zwischen den Fächern „Deutsch“ und „Geschichte und Sozialkunde“ bzw. „Politische Bildung“. Denn in der Tat bietet Musil einen wunderbaren Einstieg in eine Sozialgeschichte der späten Donaumonarchie, deren wichtigste integrative Faktoren hier angesprochen wurden: die Bürokratie, die Armee, in den schönen Bildern vom „papierweißen Arm der Verwaltung“ oder von den Straßen, die wie Flüsse der Ordnung, wie „Bänder aus hellem Soldatenzwillich“ das Reich durchzogen. Auch einige zentrale Paradoxien dieses Staatswesens werden angedeutet: liberale Verfassung, klerikale Regierungsweise, aber doch freisinniges Leben der Bürger (wir haben oben auch die Problematik dieser Zuordnungen diskutiert!). Die Nationalitätenkämpfe. Und mit der Beschreibung der neun verschiedenen Charaktere eines jeden Menschen hat Musil so nebenbei die Rollentheorie der Soziologie literarisch entfaltet (zu Musils Gesellschaftsbeobachtung vgl. Kuzmics/Mozetič 2003). Alle hier genannten „Charaktere“ (oder Rollen) sind wichtig für soziale Gruppenbildung: der Beruf, die nationale ebenso wie die Staatszugehörigkeit (welche eine so unentrinnbare Gruppenzugehörigkeit wie zum Militär, seit der allgemeinen Wehrpflicht von 1868, statuiert), die Klassenzugehörigkeit, regionale Bindungen, Geschlecht.
Musil entwarf darüber hinaus in Ansätzen eine Theorie der Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen. Am Anfang des zitierten Kapitels skizziert er, als von ihm selbst so genannte „soziale Zwangsvorstellung“, das Bild einer „Art überamerikanische Stadt“, wo
alles mit der Stoppuhr in der Hand eilt oder stillsteht. Luft und Erde bilden einen Ameisenbau, von den Stockwerken der Verkehrsstraßen durchzogen. Luftzüge, Erdzüge, Untererdzüge, Rohrpostmenschensendungen, Kraftwagenketten rasen horizontal, Schnellaufzüge pumpen vertikal Menschenmassen von einer Verkehrsebene in die andere […]. (Musil 2016a, 45)
Diese für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts recht vertraut klingende Schilderung kann in dem darein verwickelten Zeitgenossen plötzlich das Bedürfnis erwecken:
Aussteigen! Abspringen! Ein Heimweh nach Aufgehaltenwerden, Nichtsichentwickeln, Steckenbleiben, Zurückkehren zu einem Punkt, der vor der falschen Abzweigung liegt! Und in der guten alten Zeit, als es das Kaisertum Österreich noch gab, konnte man in einem solchen Falle den Zug der Zeit verlassen, sich in einen gewöhnlichen Zug einer gewöhnlichen Eisenbahn setzen und in die Heimat zurückfahren. (Musil 2016a, 47)
Das heißt nun auch: Entwicklung, Modernisierung, verstärkte Massenmobilität ist eine Sache der großen Städte, während das Land als eine Zone langsamen Wandels, ja Stillstandes gesehen wird.
Читать дальше