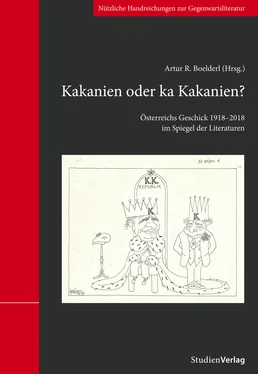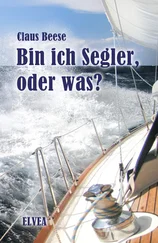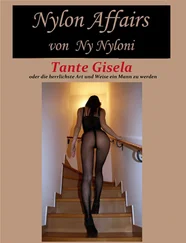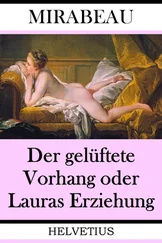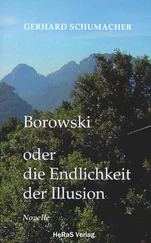Gehemmte Modernisierung oder europäische „Normalität“?
Der Kakanien-Abschnitt im Mann ohne Eigenschaften vermittelt den Eindruck einer etwas gebremsten Modernisierung und einer nur moderaten Wirtschaftsentwicklung:
Dort, in Kakanien, […] gab es auch Tempo, aber nicht zuviel Tempo. So oft man in der Fremde an dieses Land dachte, schwebte vor den Augen die Erinnerung an die weißen, breiten, wohlhabenden Straßen aus der Zeit der Fußmärsche und Extraposten, die es nach allen Richtungen wie Flüsse der Ordnung, wie Bänder aus hellem Soldatenzwillich durchzogen und die Länder mit dem papierweißen Arm der Verwaltung umschlangen. […] Natürlich rollten auf diesen Straßen auch Automobile; aber nicht zuviel Automobile! Man bereitete die Eroberung der Luft vor, auch hier; aber nicht zu intensiv. Man ließ hie und da ein Schiff nach Südamerika oder Ostasien fahren; aber nicht zu oft. […] Man gab Unsummen für das Heer aus; aber doch nur gerade so viel, daß man sicher die zweitschwächste der Großmächte blieb. Auch die Hauptstadt war um einiges kleiner als alle andern größten Städte der Welt, aber doch um ein Erkleckliches größer, als es bloß Großstädte sind. (Musil 2016a, 47 f.)
Um gleich beim Letzten zu beginnen: Wien war um 1905 die viertgrößte Stadt Europas, nach London, Paris und Berlin, und die fünftgrößte der Welt – an der Spitze lag New York. Den fünften Platz teilte sich Wien übrigens mit Chicago ( Hickmans Universal-Taschen-Atlas 1905, 25: Berlin: 2 Millionen, mit Vororten 2,85 Millionen; 31: Paris: 2,72 Millionen; 33: London: 4,6 Millionen; 39: Wien 1,88 Millionen; 63: New York: 3,72 Millionen; Grafik- und Kartenteil 25). Auf dem Kontinent lag Wien damals am dritten Platz. Die Musil-Lektüre vermittelt hier doch einen etwas „kleineren“ Eindruck. Vielleicht hat sich da während des Schreibens in den 1920er Jahren die inzwischen erfolgte Reduktion der früheren Reichshaupt- und Residenzstadt ausgewirkt?
Nun zur Wirtschaft und zu den Heeresausgaben. Mit der Wirtschaftsgeschichte der Habsburgermonarchie hat sich in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Historikern beschäftigt. Ich erwähne hier nur Gerschenkron (1988), März (1968), Good (1984), Komlos (1986), Sandgruber (1995), Rudolph (1976), Matis (1972) 6 sowie, speziell für Ungarn, Berend/Ránki (1973).
Sie stimmen soweit überein, dass
– die Habsburgermonarchie aus wirtschaftlich sehr unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Wachstumschancen bestanden, unter denen die böhmischen Länder (heute: Tschechische Republik) und (danach) die heutigen österreichischen Länder sich rascher entwickelten als andere;
– das stetige Wachstum (= Industrialisierung) um etwa 1825/30 eingesetzt habe, aber eine eindeutige „take-off“-Phase (wie in Großbritannien oder in Preußen) nicht nachweisbar sei;
– die Wachstumsraten bis um 1870 hinter dem Durchschnitt Europas lagen, dass jedoch danach ein Aufholprozess stattgefunden habe, der in Ungarn besonders stark ausgeprägt war. Die westliche Reichshälfte („Cisleithanien“) habe vor 1914 ein Pro-Kopf-Einkommen erreicht, das knapp unter dem Italiens, aber vor Spanien und Russland lag;
– man daher das Wachstumsmuster der Habsburgermonarchie weder mit England noch mit Preußen vergleichen könne, als vielmehr mit Frankreich, das einen ähnlichen, langsamen aber dauerhaften Modernisierungsprozess durchlief (vgl. Matis 1991, 113).
Der Eindruck, den Musils Kakanien-Kapitel im Hinblick auf die ökonomische Modernisierung bietet, widerspricht – alles in allem genommen – den Ergebnissen der wirtschaftshistorischen Forschung nicht. Das ,stimmt‘ auch in besonderer Weise für die Armee-Ausgaben. Musil spricht davon, dass man zwar Unsummen für die Armee ausgab, aber doch die zweitschwächste der Großmächte blieb. Im europäischen Vergleich lagen vor dem Ersten Weltkrieg die Staatsausgaben in absoluten Zahlen im Deutschen Reich am höchsten, gefolgt von Russland, Großbritannien, Frankreich und Österreich-Ungarn, pro Kopf lag Österreich-Ungarn hinter Deutschland, Großbritannien und Frankreich, auch hinter der Schweiz, aber noch vor Russland. Österreich-Ungarn hatte hohe Kosten für die Bedienung der Staatsschuld zu tragen (21 % der Gesamtausgaben) – die Folgen früherer kriegerischer Engagements (vgl. Hickmans 1905, 29). In der Heeresstärke im Frieden lag Österreich-Ungarn gemeinsam mit Großbritannien an vierter Stelle (hinter Russland, dem Deutschen Reich und Frankreich), im Kriegsfall konnte Kakanien aber erheblich mehr Mannschaften mobilisieren als Großbritannien – das dafür auf dem Meer als unschlagbar galt (203 Panzerschiffe, Österreich-Ungarn: 20). Jedenfalls rangierte Österreich-Ungarn aber überall vor Italien (offensichtlich hat Musil genau dies gemeint) (vgl. ebd., 35).
Nur kurz zum Thema der Überseeaktivitäten, die im Zeitalter des Imperialismus alle europäischen Staaten unternahmen, Kakanien jedoch nur in bescheidenem Maße: „Man ließ hie und da ein Schiff nach Südamerika oder Ostasien fahren; aber nicht zu oft“ – wir denken da sofort an die bekannte Fahrt der Fregatte Novara (1856–59) (vgl. Ortner 2011). Nun hatte Kaiser Franz I. schon 1806 eine ganze Reihe wichtiger Exponate aus der Sammlung von James Cook in London erwerben und nach Wien bringen lassen. Es gab also auch im kontinentalen Wien durchaus ein Interesse an den neuen Erkenntnissen, die sich aus diesen Reisen ergaben – und an den oft pittoresken Details, mit denen man natürlich auch ein wenig prunken konnte. Unbedingt erwähnen muss man in diesem Zusammenhang die Reisen Johann Natterers in Brasilien. Er begleitete 1817 die Kaisertochter Leopoldine auf ihrer Reise nach Brasilien zwecks Verehelichung mit dem brasilianischen Thronfolger Dom Pedro. Die sehr sorgfältig geplante Reise erbrachte etwa 150.000 Objekte, Tiere und noch viel mehr Pflanzen oder geologische Stücke, die nach Wien gelangten und heute noch zu den zentralen Beständen des Naturhistorischen Museums gehören. Natterer blieb 18 Jahre in Brasilien. Er schickte nach Wien: 1.146 Säugetiere, 12.193 Vögel, 32.825 Insekten, 1.729 Gläser mit Eingeweidewürmern, 1.621 Fische und 1.800 Ethnografica (vgl. Riedl-Dorn 2011). Wir könnten auch an die bekannte Ida Pfeiffer denken, diese mutige Weltreisende, die aber privat und nicht im öffentlichen Auftrag unterwegs war. 7
Zurück zur Novara . Auch diese Weltumseglung war sehr sorgfältig vorbereitet worden, die Geographische Gesellschaft, die Akademie der Wissenschaften, die Geologische Reichsanstalt, die Gesellschaft der Ärzte und die Zoologisch-Botanische Gesellschaft wirkten mit. Ein eigener Zeichner, Joseph Selleny, von dem überaus zahlreiche schöne Blätter erhalten sind, fuhr mit. Die Novara brachte 26.000 zoologische Exponate mit, 376 ethnographische Stücke, unzählige konservierte organische Dinge usw. Sie befinden sich größtenteils im Naturhistorischen Museum.
Wir denken ferner an die Arktis-Expedition von Peyer und Weyprecht (1872– 1874), die zwar nicht zum Nordpol führte, aber doch sehr weit in den hohen Norden kam und außerdem eine eigene Inselwelt entdeckte – das Franz Josefs-Land (vgl. Rack 2011). 1978 wurde eine Flaschenpost, die Weyprecht 1872 dem Meer übergeben hatte, von einem russischen Forscher entdeckt.
Die Weltreise des Thronfolgers Franz Ferdinand könnte ebenso unter diese Schiffsexpeditionen fallen – auch wenn sie in erster Linie der Gesundung des Erzherzogs diente. 1892/1893 hatte Franz Ferdinand auf ärztlichen Rat mit großem Gefolge eine Weltreise auf einem Kriegsschiff der österreichisch-ungarischen Marine unternommen. Man erklärte die Reise zur wissenschaftlichen Expedition, um so den wahren Zweck der Reise in den Hintergrund zu rücken. Die Reise führte von Triest nach Indien, Indonesien, Australien, Japan, Kanada und Nordamerika. Sie war auch als Sammlungsunternehmung so erfolgreich, dass sie die Grundlage für das heutige Wiener Weltmuseum bot. 14.000 ethnologische Objekte dieser Reise befinden sich heute noch dort. – Genug damit!
Читать дальше