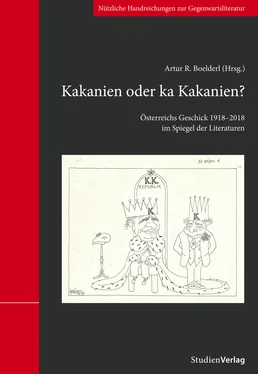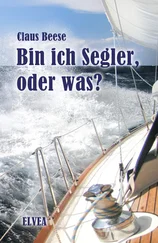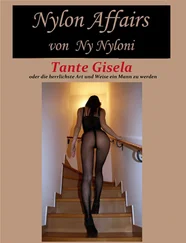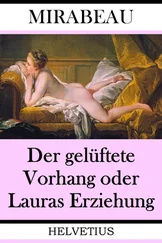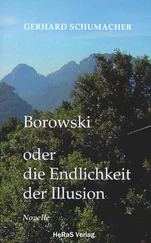Bürger oder nicht Bürger:
Staatsbürgerschaft und Heimatberechtigung
Wie sieht es aus mit den staatsbürgerlichen Rechten? Musil widmet dieser Frage genau einen merkwürdigen Satz: „Vor dem Gesetz waren alle Bürger gleich, aber nicht alle waren eben Bürger.“ (Musil 2016a, 49)
Kann man das so stehen lassen? Es bestand seit dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 1812 eine „österreichische Staatsbürgerschaft“ für alle Menschen in jenen Ländern, in denen dieses Gesetzbuch galt (also nicht in Ungarn!). Im Neoabsolutismus kam mit der Einführung des ABGB die gemeinsame Staatsbürgerschaft auch für Ungarn.
Mit dem Staatsgrundgesetz von 1867 wurde die Sache getrennt, und war nun eindeutig: Die Bewohner der „im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder“ hatten alle die österreichische Staatsbürgerschaft. Sie waren also staatsbürgerschaftlich „Österreicher“. Aber was soll der Nebensatz heißen, dass eben nicht alle Bürger waren? Spielt er vielleicht auf adlige Privilegien an, auf die Ungleichheit der Kaiserfamilie (sie unterstand ausschließlich der Gerichtsbarkeit des Kaisers!)? Wir wissen es nicht. Möglich wäre, dass Musil auf ein anderes, gesellschaftlich allerdings brennendes Problem verweist: das Heimatrecht bzw. die Zuständigkeit.
Heimatrecht und Staatsbürgerschaft hingen nämlich eng zusammen: Nur österreichische Staatsbürger hatten das Heimatrecht, und nur wer irgendwo im Kaiserstaat heimatberechtigt ist, konnte auch österreichischer Staatsbürger sein. Die leibliche Abstammung von einem Gemeindemitglied begründete die Heimatberechtigung, auch die Verehelichung – Frauen folgten hier dem Mann. Heimatberechtigung erlangten auch öffentliche Beamte an ihren Dienstorten. Die Gemeinden konnten die Aufnahme in den Gemeindeverband auch ausdrücklich aussprechen – was sie vermutlich ganz gern bei eher vermögenden Leuten machten. Der Status des Staatsbürgers war also engstens mit der Heimatberechtigung in einer bestimmten österreichischen Gemeinde verbunden:
Die im § 2 des Heimatsgesetzes 6/XII/63 R. (=Reichsgesetzblatt) 105 zum Ausdrucke gebrachte Wechselbeziehung des Heimatsrechtes und des Rechtes der Staatsbürgerschaft bringt es jedoch mit sich, daß nur eine in einer Gemeinde des Staates heimatsberechtigte Person Subject des Rechtes der Staatsbürgerschaft sein kann, sowie andererseits nur österr. Staatsbürger das Heimatsrecht in einer inländischen Gemeinde erlangen können. (Pražák 1897, 1067)
Damit der Sachverhalt nicht zu einfach ist, unterschied man zwischen „Gemeindeangehörigen“, denen das Heimatsrecht zustand, und „Gemeindegenossen“, die in der Gemeinde ein Gewerbe ausübten oder ein Grundstück besaßen, aber nicht heimatberechtigt waren. Beide Kategorien zusammen waren die „Gemeindemitglieder“. Wahlberechtigt in der Gemeinde waren beide Kategorien, aber nur die Heimatberechtigten konnten ohne Rücksicht auf ihre Steuerleistung dann in einem höheren Wahlkörper wählen, wenn sie eine höhere Bildung genossen oder aber ein öffentliches Amt bekleidet hatten (vgl. Blodig 1896, 72 und 75)
Das Heimatrecht verleiht das Recht auf ungestörten Aufenthalt. Im Prinzip konnte man ja seit den Staatsgrundgesetzen 1867 allerorten leben und wohnen, wie es einem beliebte, Arbeit suchen usw. Ein Problem tat sich auf bei Arbeitslosigkeit und folgender Armut, oder bei Armut infolge einer dauerhaften Erkrankung. Da es keine Arbeitslosenversicherung gab und die Unfall- und Krankenversicherung bis 1888 höchst rudimentär ausgebildet war, stellte sich die Frage, wer solche Personen zu erhalten hatte: Das war nun nur die Gemeinde, in der die betreffende Person heimatberechtigt war! Diese Verbindung von Heimatrecht und ,Armenpflege‘ geht schon auf das 16. Jahrhundert zurück, auf die Polizeiordnung Ferdinands I. aus dem Jahre 1555 (vgl. Mischler 1895, 65) 8 . Die Zuständigkeit zur Heimatgemeinde wurde also ausgerechnet dann schlagend, wenn der Staatsbürger (die Staatsbürgerin) sich woanders als an diesem Heimatort aufhielt und dabei das Pech hatte, zu erkranken, invalid, alt und arbeitsunfähig zu werden. Das hatte zur Folge, dass man im Verarmungsfalle in seine Heimatgemeinde abgeschoben wurde, die man vor Jahren oder Jahrzehnten verlassen hatte, weil es dort keine ausreichenden Erwerbsmöglichkeiten gab. Das Schubwesen war daher ein ständiger Diskussionspunkt in Politik und Verwaltung der späten Habsburgermonarchie (vgl. Mischler 1896). Solange es keine ausreichende Sozialversicherung gab, konnte sich die Aufenthaltsgemeinde ihrer Verpflichtung zur sozialen Fürsorge (so seit der Ersten Republik) mit der Abschiebung der Armen entziehen und sie ihren meist sowieso armen Herkunftsgemeinden überlassen. Erst 1896 hat die Gesetzgebung diese vollkommen unzureichenden Grundlagen der Gemeindearmenpflege insofern geändert, als bei längerem Aufenthalt außerhalb der Heimatgemeinde nicht mehr diese, sondern die neue Aufenthaltsgemeinde, meist eine größere Stadt oder eine Industriegemeinde, zur Armenpflege verpflichtet wurde (vgl. Hornek 1917). Man kann darin eine langsame Überwindung der Verbindung von Staatsbürgerschaft und Heimatberechtigung sehen, durch welche die faktische Begrenzung des Bürger-Status schließlich aufgehoben wurde. Reste davon blieben noch bis in die Zweite Republik erhalten. Erst 1955 ersetzte der „Staatsbürgerschaftsnachweis“ den „Auszug aus der Heimatrolle“ (vgl. Rauchenberg 1893). Also, um auf Musil zurückzukommen – es gab eine gemeinsame Staatsbürgerschaft (alle waren schon Bürger!), aber zum Unterhalt von verarmten und arbeitsunfähigen Menschen waren weder der Staat noch ein Land, noch auch die Aufenthaltsgemeinde verpflichtet, sondern die Herkunftsgemeinde. Und dieses Recht auf Abschiebung (für die Wohngemeinde) bzw. die Pflicht zu Aufnahme und Pflege (durch die Zuständigkeitsgemeinde) bedeutete tatsächlich eine Einschränkung der Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz: Wurde in Wien ein in Wien zuständiger Mensch arbeitslos, krank und erwerbsunfähig, dann hatte die wohlhabende Gemeinde Wien seinen Unterhalt zu sichern; wurde in Wien ein in Wien nicht zuständiger Mensch erwerbsunfähig, wurde er in seine womöglich in Böhmen, Galizien oder Dalmatien liegende – meist arme – Zuständigkeitsgemeinde abgeschoben. Da die Zuständigkeit auch erheiratet wurde, konnte es einer Wiener Witwe passieren, dass sie nach dem Tod ihres Mannes in dessen Heimatgemeinde abgeschoben wurde, wo sie keinen Menschen kannte und oft nicht einmal die Sprache der dortigen Menschen verstand. Mit dem Wachstum der Städte und Industriezonen wuchs das Problem (vgl. Blodig 1896). Gelöst wurde es erst in der Republik.
Verfassung und Verwaltung
Es war nach seiner Verfassung liberal, aber es wurde klerikal regiert. Es wurde klerikal regiert, aber man lebte freisinnig. Vor dem Gesetz waren alle Bürger gleich, aber nicht alle waren eben Bürger. Man hatte ein Parlament, welches so gewaltigen Gebrauch von seiner Freiheit machte, daß man es gewöhnlich geschlossen hielt; aber man hatte auch einen Notstandsparagraphen, mit dessen Hilfe man ohne das Parlament auskam, und jedesmal, wenn alles sich schon über den Absolutismus freute, ordnete die Krone an, daß nun doch wieder parlamentarisch regiert werden müsse. Solcher Geschehnisse gab es viele in diesem Staat, und zu ihnen gehörten auch jene nationalen Kämpfe, die mit Recht die Neugierde Europas auf sich zogen und heute ganz falsch dargestellt werden. Sie waren so heftig, daß ihretwegen die Staatsmaschine mehrmals im Jahr stockte und stillstand, aber in den Zwischenzeiten und Staatspausen kam man ausgezeichnet miteinander aus und tat, als ob nichts gewesen wäre. (Musil 2016a, 49 f.)
Die Musil’sche Ironie bedient sich in genialer Weise diverser Paradoxien: liberale Verfassung – klerikale Regierung; klerikale Regierung – freisinniges Leben, willkommener Absolutismus – Parlamentarismus. Es würde viel zu weit führen, wollte man dem allen ,historisch‘ nachgehen. Außerdem können literarische Topoi wohl kaum als ,historische‘ Aussagen gelten – dennoch sind sie in ihren Verkürzungen enorm anregend im Hinblick auf weitere Nachfragen. Etwa die nach einer ,klerikalen‘ Regierung Kakaniens: In Ungarn war jedenfalls davon keine Rede, das ungarische Rechtssystem stellte sukzessive alle Religionen und Konfessionen gleich, alle ungarischen Regierungen waren in ihrer Distanz zur (katholischen) Kirche jedenfalls nach damaligen Maßstäben ,liberal‘ (obwohl sie dies keineswegs gegenüber den nichtmagyarischen Minderheiten waren). Aber auch in Österreich waren von 1867 bis 1879 liberale Regierungen am Werk, die die bisher unbestrittene Dominanz der katholischen Kirche kräftig zurückstutzten. Das änderte sich ein wenig unter dem Ministerpräsidenten Taaffe (1879–1893), in dessen Eisernem Ring die katholischkonservativen Parteien der Alpenländer eine wichtige Rolle spielten. Man hat jetzt auch die Klagen der Kapläne erhört, die über ihre karge ,Kongrua‘ (Entlohnung der Priester aus den Religionsfonds) jammerten. Aber richtig ,klerikal‘ waren weder Taaffe noch die meisten seiner Minister. Hingegen hielt der Kaiser streng an seinem Glauben fest. In der Regel waren auch die hohen Beamten alte oder neue ,Josephiner‘, zweifellos waren nur die wenigsten ,klerikal‘. Das änderte sich ab dem Aufkommen von Massenparteien, die mit dem neuen politischen Katholizismus verbunden waren, etwa den oberösterreichischen, steirischen oder salzburgischen Konservativen. Diese vertraten in der Regel in strittigen Fragen die Positionen der Bischöfe. Aber erst im 20. Jahrhundert wurde ein Mann aus diesen Parteien, der Oberösterreicher Ebenhoch, für kurze Zeit Minister. Ob die jüngeren Christlichsozialen, die nacheinander Vorarlberg, Tirol und Niederösterreich (mit Wien) eroberten, wirklich ,klerikal‘ waren? Tatsächlich waren sie eine Koalition, zu der neben protestierenden antisemitischen Kleinbürgern und Bauern auch Kapläne gehörten, aber keine Bischöfe. Das änderte sich grundlegend erst mit der Republik. Aber zweifellos war der Katholizismus zumindest in „Cisleithanien“ die privilegierte Konfession, die auch immer wieder ihr wichtige Positionen erfolgreich verteidigen konnte. Eine Zivilehe wie in Ungarn wurde in Cisleithanien eben nicht eingeführt. Daneben lebten freilich die Menschen zunehmend nach ihrer Fasson, und die wurde immer individualistischer und immer weniger von den Lehren der heiligen Kirche bestimmt – man lebte ,freisinnig‘. – Musils Ironie und seine Neigung zu Paradoxien führen uns in diesem Bereich doch ein wenig in die Irre – allerdings dann wieder nicht, wenn man das ,klerikale‘ Regime nicht in den Regierungen sucht, sondern in der sozialen Praxis etwa des Schulbetriebes, in dem die Verpflichtung zur Teilnahme an Gottesdiensten durchaus etwas Selbstverständliches war.
Читать дальше