17Nach den absoluten Straftheorien(Vertreter insbesondere Immanuel Kant und Georg Friedrich Wilhelm Hegel ) ist die Strafe unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Wirkung, d. h. unabhängig von ihrem Zweck zu sehen. Sie dient allein dazu, die Rechtsordnung wiederherzustellen und auf das begangene Unrecht zu reagieren. Insofern wirkt sie ausschließlich repressiv und hat damit vergeltenden Charakter. Der Täter müsse bestraft werden, „weil“ er eine Straftat begangen hat und nicht deswegen, weil er durch die verhängte bzw. vollstreckte Strafe gebessert würde oder andere durch die Bestrafung des Täters von der Begehung eigener Straftaten abgeschreckt werden könnten. Würde er als Mittel zum Zweck bestraft, verstieße dies als Einschränkung seiner Freiheit sogar gegen die Menschenwürde. Verwandt hiermit ist auch die Sühnetheorie, die darauf abstellt, durch die Strafe würde sich der Täter mit der Rechtsordnung wieder versöhnen.
18Dagegen gehen die relativen Straftheoriendavon aus, dass mit der Verhängung von Strafe jeweils die Verfolgung eines bestimmten Zwecks verbunden sein muss. Strafe dürfe nicht repressiv (d. h. in die Vergangenheit orientiert) sein, sondern müsse präventiv (d. h. in die Zukunft gerichtet) wirken. Der Hauptzweck von Strafe liege letztlich darin, künftige Straftaten zu verhindern. Dabei werden zwei Ansätze vertreten:
19Nach der Theorie der Generalprävention(Vertreter insbesondere Paul Johann Anselm v. Feuerbach ) steht die Wirkung der Strafe auf die Allgemeinheit (und nicht auf den Täter selbst) im Mittelpunkt der Betrachtung. Durch die Verhängung von Strafe werde das Rechtsbewusstsein der Bevölkerung und das Vertrauen der Allgemeinheit gestärkt, was dazu führe, dass auch die anderen Mitglieder der Gesellschaft dazu motiviert werden, die Gesetze einzuhalten und sich insgesamt rechtstreu zu verhalten („positive Generalprävention“). Darüber hinaus führe die Bestrafung Einzelner aber auch dazu, dass andere künftig von der Begehung von Straftaten abgehalten werden, d. h. durch die Bestrafung des Täters „abgeschreckt“ werden („negative Generalprävention“).
20Dagegen rückt die Theorie der Spezialprävention(Vertreter insbesondere Franz v. Liszt ) die Wirkung der Strafe für den betroffenen Einzelnen in den Mittelpunkt. Die Strafe solle einerseits zur Besserung des Täters führen und eine Appellfunktion dahingehend besitzen, dass er fortan ein straffreies Leben führe („positive Spezialprävention“), andererseits solle sie bei nicht besserungsfähigen Tätern die Gesellschaft vor diesen Tätern schützen („negative Spezialprävention“).
21Da keine der genannten Theorien vollständig überzeugen bzw. im Hinblick auf jeden Täter und jede Tat eine „stimmige“ Lösung bieten kann, haben sich inzwischen mehrere sog. Vereinigungstheorienentwickelt, die je nach Ausprägung zwar den Schwerpunkt auf den einen oder anderen Aspekt legen, im Ergebnis aber die genannten Theorien miteinander verbinden. Auch im StGBklingen im Rahmen der Strafzumessung sämtliche Theorien an: So ist nach § 46 Abs. 1 Satz 1 StGB die Schuld Grundlagefür die Zumessung der Strafe (repressiver Aspekt = Sühne- oder Vergeltungsgedanken). Nach § 46 Abs. 1 Satz 2 StGB ist bei der Strafzumessung auf die Wirkungen abzustellen, die von der Strafe für das weitere Leben des Täters zu erwarten sind (spezialpräventiver Ansatz). Schließlich soll nach § 47 Abs. 1 StGB eine Freiheitsstrafe unter sechs Monaten nur verhängt werden, wenn sie zur Einwirkung auf den Täter (Spezialprävention) oder zur Verteidigung der Rechtsordnung (Generalprävention) unerlässlich ist.
Literaturhinweise
Lesch , Zur Einführung in das Strafrecht: Über den Sinn und Zweck staatlichen Strafens, JA 1994, 510, 590 (ausführlicher Überblick mit verständlichem Bezug zu den historischen Wurzeln der Straftheorien); Momsen/Rackow , Die Straftheorien, JA 2004, 336 (verständliche Einführung anhand von Beispielsfällen)
IV.Verfassungsrechtliche Einflüsse auf das Strafrecht
22Gerade im Strafrecht spielen verfassungsrechtliche Vorgaben an vielen Stellen eine Rolle. Dies gilt nicht nur für das „materielle“ Strafrecht (die einzelnen Strafnormen und die allgemeinen strafrechtlichen Grundsätze) 7, sondern vor allem auch für das Strafprozessrecht (sog. „formelles“ Strafrecht), insbesondere die strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen. An dieser Stelle soll allerdings ein grober Überblick über die verfassungsrechtlichen Einflüsse genügen. 8
 Klausurtipp
Klausurtipp
Zwar wird in einer strafrechtlichen Klausur regelmäßig nicht erwartet, die Verfassungsmäßigkeit einer bestimmten Strafvorschrift zu prüfen. Mitunter können aber verfassungsrechtliche Grundsätze, wie z. B. das Analogieverbot oder der Bestimmtheitsgrundsatz, die Auslegung von Straftatbeständen im konkreten Fall beeinflussen. Auch Grundrechte sind zuweilen im Rahmen dieser Auslegung zu beachten, man denke nur an die Meinungsfreiheit, Art. 5 Abs. 1 GG, oder die Kunstfreiheit, Art. 5 Abs. 2 GG, welche im Rahmen der Beleidigungsdelikte, §§ 185 ff. StGB, zu berücksichtigen sind.
1.Grundsatz „nulla poena sine lege“
23Im Zentrum steht hierbei der erstmals von Anselm v. Feuerbach im Jahre 1801 geprägte Grundsatz „nulla poena sine lege“(keine Strafe ohne Gesetz), der sich wortgleich in Art. 103 Abs. 2 GG und § 1 StGB findet. Etwas konkreter wird dieser Grundsatz auch in Art. 7 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) gefasst, die in Deutschland im Range eines einfachen Bundesgesetzes gilt.
 Gesetzestext
Gesetzestext
Art. 103 Abs. 2 GG/§ 1 StGB: Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
Art. 7 Abs. 1 EMRK: Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach inländischem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine höhere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden.
24Der Grundsatz „nulla poena sine lege“ (oder ganz korrekt: „nullum crimen, nulla poena sine lege “, da nicht nur die Strafe als Rechtsfolge, sondern auch und gerade die Strafbarkeit an sich gesetzlich bestimmt sein muss) stellt zum einen eine Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips, Art. 20 Abs. 3 GG, dar, denn um in ausreichendem Maße Rechtssicherheit zu gewährleisten, muss jeder Bürger wissen, welches Verhalten strafbar ist und welches nicht – man spricht hier auch von der „Garantiefunktion des Strafrechts“. Zum anderen folgt er auch aus dem Prinzip der Gewaltenteilung:der Gesetzgeber – und nicht der Richter – hat festzulegen, welches Verhalten strafbar sein soll. Insgesamt lassen sich aus dem Grundsatz „nulla poena sine lege“ vier verschiedene Ausprägungen ableiten:
25 a) Unzulässigkeit von Gewohnheitsrecht („nulla poena sine lege scripta“).Nur ein geschriebenes Gesetz kann die Strafbarkeit eines Verhaltens begründen und eine bestimmte Strafe als Rechtsfolge androhen. Dagegen ist die Begründung einer Strafbarkeit durch Gewohnheitsrecht unzulässig. Unter Gewohnheitsrecht versteht man hierbei eine gerade nicht durch ein Gesetz festgelegte rechtliche Regelung, die seit längerem (auch von den Gerichten) angewandt wird und von einer allgemeinen Rechtsüberzeugung getragen wird. Eben dies ist im Strafrecht unzulässig. Das strikte Verbot der Anwendung von Gewohnheitsrecht gilt allerdings nur zu Lastendes Täters. Gewohnheitsrechtliche Regelungen zugunsten des Täters sind hingegen zulässig – man denke hier nur an den gewohnheitsrechtlich begründeten Rechtfertigungsgrund der Einwilligung. 9
Читать дальше
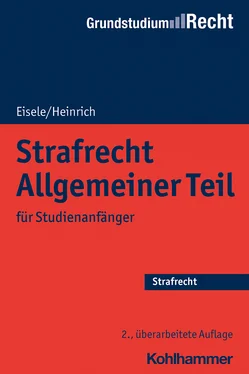
 Klausurtipp
Klausurtipp Gesetzestext
Gesetzestext










