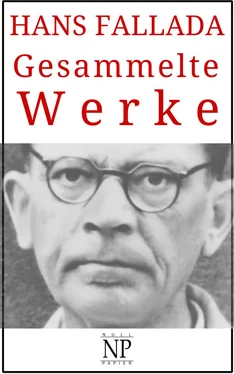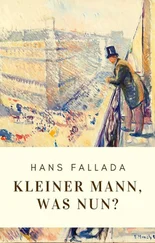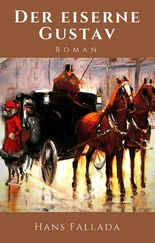»Wenn’s klingelt, Anna«, sagte er, »machst du nicht eher auf, als bis ich …«
»Wer soll denn klingeln, Otto?«, fragte sie ungeduldig. »Wer soll denn zu uns kommen? Nun sage schon, was du sagen willst!«
»Ich werd’s schon sagen, Anna«, antwortete er mit ungewohnter Milde. »Aber wenn du mich drängelst, machst du es mir nur noch schwerer.«
Sie berührte schnell seine Hand, die Hand dieses Mannes, dem jede Mitteilung dessen, was in seinem Innern vorging, immer wieder schwerfiel. »Ich werde dich schon nicht drängeln, Otto«, sagte sie beruhigend. »Lass dir Zeit!«
Aber gleich darauf begann er zu sprechen, und nun sprach er fast fünf Minuten hintereinander, in langsamen, kurz abgerissenen, sehr überlegten Sätzen, hinter deren jedem er erst einmal fest den schmallippigen Mund schloss, als komme nun bestimmt nichts mehr. Und während er so sprach, hatte er den Blick auf etwas gerichtet, was seitlich hinter Anna in der Stube war.
Anna Quangel aber hielt die Augen während seines Sprechens fest auf sein Gesicht gewendet, und sie war ihm fast dankbar, dass er sie nicht ansah, so schwer wurde es ihr, die Enttäuschung, die sich immer stärker ihrer bemächtigte, zu verbergen. Mein Gott, was hatte sich dieser Mann da ausgedacht! Sie hatte an große Taten gedacht (und sich eigentlich auch vor ihnen gefürchtet), an ein Attentat auf den Führer, zum mindesten aber an einen tätigen Kampf gegen die Bonzen und die Partei.
Und was wollte er tun? Gar nichts, etwas lächerlich Kleines, so etwas, das so ganz in seiner Art lag, etwas Stilles, Abseitiges, das ihm seine Ruhe bewahrte. Karten wollte er schreiben, Postkarten mit Aufrufen gegen den Führer und die Partei, gegen den Krieg, zur Aufklärung seiner Mitmenschen, das war alles. Und diese Karten wollte er nun nicht etwa an bestimmte Menschen senden oder als Plakate an die Wände kleben, nein, er wollte sie nur auf den Treppen sehr begangener Häuser niederlegen, sie dort ihrem Schicksal überlassen, ganz unbestimmt, wer sie aufnahm, ob sie nicht gleich zertreten wurden, zerrissen … Alles in ihr empörte sich gegen diesen gefahrlosen Krieg aus dem Dunkeln. Sie wollte tätig sein, es musste etwas getan werden, von dem man eine Wirkung sah!
Quangel aber, nachdem er zu Ende geredet hatte, schien gar keine Erwiderung von seiner Frau zu erwarten, die da still mit sich kämpfend in ihrer Sofaecke saß. Sollte sie ihm nicht doch lieber etwas sagen?
Er war aufgestanden und wieder zum Lauschen an die Flurtür gegangen. Als er zurückkam, nahm er nur die Decke vom Tisch, faltete sie zusammen und hängte sie sorgfältig über die Stuhllehne. Dann ging er an den alten Mahagonisekretär, suchte das Schlüsselbund aus seiner Tasche hervor und schloss auf.
Während er noch im Schranke kramte, entschloss sich Anna. Zögernd sagte sie: »Ist das nicht ein bisschen wenig, was du da tun willst, Otto?«
Er hielt inne in seiner Kramerei, noch gebückt dort stehend, drehte er den Kopf seiner Frau zu. »Ob wenig oder viel, Anna«, sagte er, »wenn sie uns darauf kommen, wird es uns unsern Kopf kosten …«
Es lag etwas so schrecklich Überzeugendes in diesen Worten, in dem dunklen, unergründlichen Vogelblick, mit dem der Mann sie in dieser Minute ansah, dass sie zusammenschauderte. Und einen Augenblick sah sie deutlich vor sich den grauen, steinernen Gefängnishof, das Fallbeil aufgerichtet, in dem grauen Frühlicht hatte sein Stahl nichts Glänzendes, es war wie eine stumme Drohung.
Anna Quangel spürte, dass sie zitterte. Dann sah sie rasch wieder zu Otto hinüber. Er hatte vielleicht recht, ob wenig oder viel, niemand konnte mehr als sein Leben wagen. Jeder nach seinen Kräften und Anlagen – die Hauptsache: man widerstand.
Noch immer sah Quangel sie stumm an, als beobachte er den Kampf, den sie in sich kämpfte. Nun wurde sein Blick heller, er nahm die Hände aus dem Sekretär, richtete sich auf und sagte fast lächelnd: »Aber so leicht sollen die uns nicht kriegen! Wenn die schlau sind, wir können auch schlau sein. Schlau und vorsichtig. Vorsichtig, Anna, immer auf der Hut – je länger wir kämpfen, umso länger werden wir wirken. Es nützt nichts, zu früh zu sterben. Wir wollen leben, es noch erleben, dass die fallen. Wir wollen dann sagen können, wir sind auch dabei gewesen, Anna!«
Er hatte diese Worte leicht, fast scherzend gesprochen. Nun, während er wieder kramte, lehnte sich Anna erleichtert in das Sofa zurück. Eine Last war ihr abgenommen, jetzt war sie auch davon überzeugt, dass Otto etwas Großes vorhatte.
Er trug sein Fläschchen Tinte, seine in einem Umschlag befindlichen Postkarten, die weißen, riesigen Handschuhe an den Tisch. Er zog den Pfropfen aus der Flasche, glühte mit einem Streichholz die Feder aus und steckte sie in die Tinte. Es zischte leise, er besah aufmerksam die Feder und nickte dann. Nun zog er umständlich die Handschuhe an, nahm eine Karte aus dem Umschlag, legte sie vor sich hin. Er nickte Anna langsam zu. Sie hatte jeden dieser behutsamen, lange vorbereiteten Griffe mit aufmerksamem Auge verfolgt. Nun deutete er auf die Handschuhe und sagte: »Wegen Fingerabdrücken – du verstehst!«
Dann nahm er die Feder zur Hand und sagte leise, aber mit Nachdruck: »Der erste Satz unserer ersten Karte wird lauten: ›Mutter! Der Führer hat mir meinen Sohn ermordet‹ …«
Und wieder erschauerte sie. Es lag etwas so Unheilvolles, so Düsteres, so Entschlossenes in diesen Worten, die Otto eben gesprochen hatte. Sie begriff in einem Augenblick, dass er mit diesem ersten Satz für heute und ewig den Krieg angesagt hatte, und sie erfasste auch dunkel, was das hieß: Krieg zwischen ihnen beiden, den armen, kleinen, bedeutungslosen Arbeitern, die wegen eines Wortes für immer ausgelöscht werden konnten, und auf der anderen Seite der Führer, die Partei, dieser ganze ungeheure Apparat mit all seiner Macht und seinem Glanz und drei Viertel, ja vier Fünftel des ganzen deutschen Volkes dahinter. Und sie beide hier in diesem kleinen Zimmer in der Jablonskistraße allein!
Sie sieht zu dem Manne hinüber. Während sie dies alles gedacht hat, ist er erst beim dritten Wort des ersten Satzes angekommen. Unendlich geduldig malt er das »F« von Führer hin. »Lass mich doch schreiben, Otto!«, bittet sie. »Bei mir geht das viel schneller!«
Erst knurrt er wieder nur. Aber dann gibt er ihr doch eine Erklärung. »Deine Handschrift«, sagt er. »Sie würden uns früher oder später durch deine Handschrift erwischen. Dies ist eine Kunstschrift, Blockschrift – du siehst, eine Art Druckbuchstaben …«
Er verstummt wieder, malt weiter. Ja, so hat er es sich ausgedacht. Er glaubt nicht, dass er was vergessen hat. Diese Kunstschrift kannte er von den Möbelzeichnungen der Innenarchitekten her, niemand kann einer solchen Schrift ansehen, von wem sie stammt. Natürlich fällt sie bei Otto Quangels schreibungewohnten Händen sehr grob und klobig aus. Aber das schadet nichts, das verrät ihn nicht. Es ist eher gut, so bekommt die Karte etwas Plakatartiges, das sofort das Auge auf sich zieht. Er malt geduldig weiter.
Читать дальше