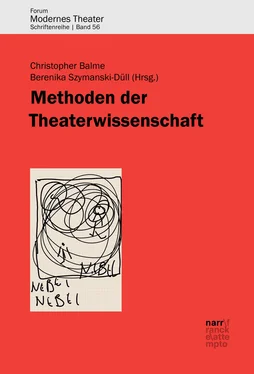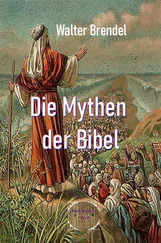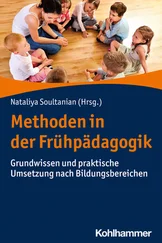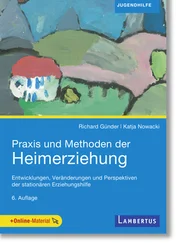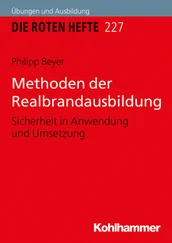Eine Differenz zu betonen zwischen solchen Schreibweisen, die das eigene Empfinden in den Mittelpunkt rücken, und anderen, die sich auf das Beschreiben von Relationen im Aufführungsraum konzentrieren, darf den Blick nicht davor verschließen, dass Aufführungsanalysen immer an spezifische Perspektiven und Positionen gebunden sind. Die Perspektivik des Beschreibens ist unhintergehbar, und man würde hinter die Standards schon der frühen, semiotischen Aufführungsanalyse zurückfallen, wenn man die Abhängigkeit des Analysierens von der eigenen sozialen und kulturellen Situiertheit leugnen wollte. Aus der Anerkennung dieser grundsätzlichen Perspektivik aufführungsanalytischen Schreibens lassen sich aber unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Man kann sich umso entschiedener auf die sprachliche Repräsentation des eigenen Erlebens festlegen.2 Eine andere Vorgehensweise, für die ich hier plädieren möchte, relativiert die eigene Position durch eine relationale Perspektive – und interessiert sich darüber hinaus für die Frage, wo sich die verschiedenen Perspektiven auf die Aufführung manifestieren bzw. an welchen Materialien sie untersucht werden können.
Eine Theateraufführung, das sei hier nur als Ausblick angedeutet, bringt solche Materialien selbst hervor. Aufführungen sind nicht nur auf Diskurse bezogen, sie generieren auch ihrerseits Diskurse, und diese generative Seite von Aufführungen müsste in der Analyse stärker beachtet werden. Was bedeutet es, Aufführungen als diskursgenerierende Ereignisse zu konzeptualisieren? Es bedeutet ernst zu nehmen, dass das Hier und Jetzt der Aufführung in allen Richtungen diskursive Erweiterungen hervorbringt. Die Texte, in denen sich diese Weiterungen niederschlagen, reichen von frühen Interviews mit dem Dramaturgen oder der Regisseurin über Programmhefte, Notizen und Diskussionsprotokolle von den Proben, Vorabberichte der Presse, Publikumsgespräche, begleitende Podiumsdiskussionen bis hin zu Rezensionen, Blogs und weiteren Rezeptionsdokumenten. Durch Interviews mit Teilnehmenden hat die Theaterwissenschaft die Möglichkeit, die Palette der aus der Aufführung heraus entstehenden Texte sogar noch zu erweitern. Sicher kann man einwenden, dass auch diese Materialien bei weitem nicht alle Perspektiven auf die Aufführung abdecken und erneut nur die Sichtweise eines ohnehin schon dominanten ‚Theatermilieus‘ reproduzieren. Gleichwohl zeigt sich, dass die von der Aufführung generierten Texte von innerer Vielstimmigkeit geprägt sind und auf Machtkonflikte und Deutungskontroversen hinweisen, die einer internalistischen Sichtweise verborgen bleiben würden.
Von der Aufführung zum Dispositiv
Gerald Siegmund und Lorenz Aggermann
Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Frage, wie die Aufführung unter zeitgenössischen Bedingungen, in denen Kunst produziert und rezipiert wird, definiert und untersucht werden kann. Denn wie wir gegenwärtig verstärkt bemerken und erfahren dürfen, sind ihre Grenzen und damit auch sie selbst nicht mehr klar zu umreißen. Was gehört noch zur Aufführung, wenn Künstler wie etwa Heiner Goebbels nicht nur Bühnenstücke in Szene setzen, sondern daraus Hörstücke entwickeln, Partituren und Bücher veröffentlichen oder gar, wie im Falle von Schwarz auf Weiß , Filme realisieren? Oder wenn Hans Neuenfels, wie zum Beispiel im Falle von Europa und der zweite Apfel den Film als einen notwendigen Katalysator seiner Inszenierung Der tollwütige Mund ansieht, ohne welchen die Aufführung nicht ihre Gestalt fände? Woran sich halten, wenn bspw. bei Marten Spangberg die Choreographie die Form eines Buchs annimmt, auf dessen ersten Seiten sogleich behauptet wird: „this book is a performance.“ 1?
Zeitgenössische darstellende Kunst ist, wie der britische Philosoph Peter Osborne es formuliert, post-konzeptionelle Kunst, die sich in verschiedenen Formaten und Medien materialisiert und deshalb überall auf der Welt stattfinden kann. In unserem Verständnis sind diese anderen Formate der Aufführung nicht äußerlich. Sie sind nicht in erster Linie ökonomische Zweitverwertungen, sondern dem Material bereits eingeschriebene Formen, die sich in der Aufführung allein nicht umfassend materialisieren können. Der Ansatz, der uns zu einem erweiterten Verständnis von Aufführung führen soll, ist jener des Dispositivs. Die Aufführung ist die Materialisation eines ästhetischen Dispositivs.2
Rückt man von der Vorstellung von Theater und seiner Aufführung in diesem Sinne als einem gegebenen Gegenstand ab und versteht es unter epistemologischen Prämissen als ein historisches und konzeptionelles Phänomen, das erst in seiner Vermessung konturiert oder gar produziert wird, so ergeben sich andere Fragen, die infolge womöglich im Zentrum einer zeitgenössischen Theaterwissenschaft stehen – nicht jene nach dem ontologischen Status der Aufführung oder der Kunst, sondern jene nach ihrer epistemischen und dispositivischen Verfasstheit: Was weiß die darstellende Kunst und ihre spezifische Ordnung, und mehr noch, was lässt uns ihre Rezeption wissen? Welche Elemente finden darin Eingang, welche Beziehung haben diese zueinander, zu den Beobachtenden, zu anderen Ordnungen? Welche Dynamiken sind innerhalb dieser Beziehungen am Werk, und in welcher Konstellation materialisieren sich diese Elemente und Beziehungen? Wer oder was regiert die Ordnung der Aufführung? Welche anderen Materialisationen gibt es darüber hinaus? Und vor allem: worauf antworten das je spezifische Dispositiv Theater respektive seine Materialisation in der Aufführung oder in anderweitigen Formaten?
Zur Definition des Dispositivs
Sein maßgebliches Fundament findet der Begriff des Dispositivs in der Epistemologie Michel Foucaults, der seine Schriften als latentes Konzept durchzieht und der für Foucault einen allgemeinen Fall der Episteme, also einer spezifischen Anordnung, darstellt.1 Der Begriff Dispositiv, der im Französischen recht gebräuchlich ist und mit Werkzeug, Gerät, Maßnahme, Vorrichtung, Apparat oder Modell übersetzt werden kann, steht hierbei für eine offene Ordnung, die je nach Zeiten und Räumen aus unterschiedlichen Elementen besteht, die wiederum je spezifisch konstelliert sind und gerade in ihrer Offen- und Unabgeschlossenheit die wesentliche Funktionsweise eines Dispositivs bestimmen. Anders als beispielsweise ein Mechanismus oder Apparat – Termini, mit denen der Begriff Dispositiv ebenfalls immer wieder übersetzt wird und die stärker auf technische oder kausal-logische Verknüpfungen abheben – versteht sich das Dispositiv als eine abstrahierte Ordnung, die nach bestimmten, jedoch nicht immer durchschaubaren Regeln funktioniert.
In der zweiten Hälfte der 1970er verwendet Foucault in seinen Texten den Begriff Dispositiv immer häufiger, womit auch eine maßgebliche Erweiterung seiner Epistemologie einhergeht. Auch das Dispositiv wird von ihm als ein „entschieden heterogenes Ensemble“2 gefasst, das diskursive und nicht-diskursive Phänomene, „Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes“3 beinhaltet. Es ist weniger die Rejustierung des Modells auf Nichtdiskursives, Materielles und Tätigkeiten, mithin Praxen, die das Dispositiv vom Konzept der Ordnung unterscheidet. In der Neukonzeption verschiebt sich die Aufmerksamkeit von der Heterogenität und Inkommensurabilität der Elemente auf ihre Ausrichtung und Anordnung, auf ihre Konstellation und Dynamik. Der Begriff Dispositiv soll daher primär die Verbindung zwischen diesen Elementen deutlich machen und die Ordnung als eine dynamische und energetische Konstellation fassen, die sich zu einer bestimmten Zeit ausbildet, um ein Problem in anderen, gesellschaftlichen und kulturellen, Ordnungen zu lösen. Damit werden vor allem die Kräfteverhältnisse einer Ordnung und ihre Lenkung bedeutsam. Foucault beschreibt das Dispositiv als eine „Formation, deren Hauptfunktion zu einem historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand zu antworten.“4 Es reagiert mittels seiner Dynamik auf die Dysfunktionalität einer Anordnung, manipuliert Dinge und deren Verhältnis untereinander zu einem bestimmten Zweck. Dispositiven kommt somit ein intentionaler, strategischer Charakter zu. In ihnen tritt vornehmlich das hervor, was die Ordnung der Dinge regiert.
Читать дальше