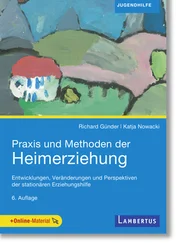Das Problem liegt hier weniger im Sollen als im Können: Wenn man sich von psychoanalytischen Subjektmodellen nicht gänzlich verabschieden möchte, muss man damit rechnen, dass das Subjekt seine identitären Prägungen gerade nicht vollständig überschauen kann, sondern dass diese, bis in die Feinheiten der sexuellen Orientierung, weitgehend im Unbewussten operieren. Deshalb kann es vermessen wirken, wenn ein*e Autor*in glaubt, die eigene Subjektposition ebenso vollständig wie sortiert offenlegen zu können. Die Forderung, das Beschreiben von Aufführungen mit einer möglichst vollständigen Explikation der eigenen sozialen, kulturellen und politischen Situiertheit zu verbinden, birgt enorme Schwierigkeiten und kann in den resignativen Rückzug aus der Aufführungsanalyse münden. Jedenfalls fällt auf, dass in vielen Büchern und Aufsätzen zu Themen wie Theater und Migration, politisches Theater oder angewandtes Theater kaum mehr aufführungsanalytisch argumentiert wird. Nicht immer wird ausdrücklich gefordert, kunstwissenschaftliche Betrachtungsweisen durch ethnographische und sozialwissenschaftliche Verfahren zu ersetzen, aber die Praxis vieler Autor*innen auf den genannten Feldern weist in diese Richtung. So entstehen Bücher über Theater, in denen man nur noch wenig darüber erfährt, was auf der Bühne zu sehen ist und im Aufführungsraum geschieht.
Aus theaterwissenschaftlicher Perspektive ist das zu beklagen, denn Fragen nach Diversität und Perspektivik entziehen dem aufführungsanalytischen Blick sicher nicht die Legitimation – wohl aber deren Selbstverständlichkeit. Es sind vor allem zwei Herausforderungen, mit denen Aufführungsanalysen in der Beschäftigung mit postmigrantischen Inszenierungen umzugehen haben: Zum einen handelt es sich hier um ein Theater, das sich geradezu programmatisch gegen unidirektionale Fremdzuschreibungen wendet. Postmigrantisches Theater ist entstanden als eine Kritik an der Selbstgewissheit, mit der Angehörige einer angeblich alt-eingesessenen Bevölkerungsmehrheit Menschen mit Migrationshintergrund bestimmte Einstellungen, Lebenshaltungen und Gefühle unterstellen. Von daher wäre es unangebracht, wenn die Aufführungsanalyse sich nun – in semiotischer Tradition – darum bemühen würde, den von den Akteuren stimmlich, mimisch und gestisch gebotenen Zeichen einzelne Bedeutungen zuzuschreiben. Die erste Herausforderung besteht also darin, ein schlichtes Ausdeuten individueller Anzeichen für bestimmte Gefühlslagen zu vermeiden. Zum anderen hat postmigrantisches Theater eine markant politische Stoßrichtung, die in einer rein phänomenologischen Perspektive leicht verfehlt werden kann, zumindest wenn sich diese Perspektive darin erschöpft, dass man das eigene ‚leibliche Spüren‘ in der Inszenierung genau registriert und beschreibt. Denn mit welchem Recht ließe sich dieses Spüren in der Analyse über die Erfahrungen anderer Aufführungsteilnehmer*innen stellen? Die zweite Herausforderung liegt deshalb in der Notwendigkeit, die eigene Position und das eigene Empfinden in der Aufführung nicht zu universalisieren.
Eine Antwort auf beide Herausforderungen kann es sein, sich auf materielle Relationen zu konzentrieren und entsprechend Affizierungen zwischen Akteuren, Objekten, Stimmen, Sprachen und deren räumlichen Anordnungen herauszuarbeiten. Es mag auf den ersten Blick kontraintuitiv wirken, auf den Subjektivitäts-Vorwurf gerade mit einer Fokussierung des Affektiven zu reagieren. Aber als relationales Konzept ist Affektivität tatsächlich geeignet, die in der Aufführung gemachten Beobachtungen nicht gleich entlang einer Subjekt-Objekt-Dichotomie zu organisieren. Affektivität lässt sich nur aus einer Perspektive beschreiben, die transindividuelle Prozesse in den Blick nimmt und dabei neben menschlichen Akteuren, ihren Körpern und Stimmen, auch Dinge, Objekte, Bewegungen und materielle Arrangements berücksichtigt.1 Um diese Perspektive einzunehmen, kann es helfen, nicht konkrete Interaktionen zwischen Individuen zu beschreiben, sondern sich auf die materielle Transformation einzelner Elemente zu konzentrieren: Wie wird zum Beispiel der Text, der der Inszenierung zugrunde liegt, in verschiedene materielle Register übersetzt? In welchen Relationen steht das in sich hochdifferenzierte sprachliche Material zu anderen Materialien der Aufführung, und welche Bewegungen und affektiven Arrangements ergeben sich daraus? Eine solche Fragerichtung der Aufführungsanalyse soll im Folgenden zunächst auf der Grundlage einer knappen Begriffsbestimmung und dann an einem Inszenierungsbeispiel angedeutet werden.
Die affektive Dimension von Aufführungen zu beleuchten, bedeutet nicht, das emotionale Erleben einzelner Zuschauer*innen zu rekonstruieren oder überhaupt individuelle Gefühle zu beschreiben. Die hier vorgeschlagene Perspektive geht vielmehr von einer Unterscheidung zwischen Affekt und Emotion aus.1 Affektivität ist demnach das dynamische Geschehen, das verschiedene Akteure auf vielfältige Weise miteinander in Beziehung setzt. Affekte finden also eher zwischen Akteuren statt als in ihnen (wobei unter Akteuren immer auch nicht-menschliche Handlungsträger oder Adressaten von Handlungen verstanden werden können). Gerade durch diesen relationalen Charakter sind Affekte von Emotionen als individuellen psychischen Zuständen zu unterscheiden. Anders als eine Emotion, ein Gefühl oder eine Stimmung ist der Affekt eine weitgehend unbestimmte Größe. Affekte bemessen sich zunächst in ihrer Intensität, sind hingegen noch nicht in ihrer Gerichtetheit, Wertung oder Artikulation bestimmbar – bevor sie in kulturell bzw. diskursiv etablierte Bahnen gelenkt und auf spezifische Weise ausagiert werden können. So entziehen sie sich oft auch einer präziseren sprachlichen Bezeichnung. Dagegen sind Emotionen soweit kulturell codiert, dass sie sprachlich repräsentiert werden können. Emotionen rekurrieren auf Affekte, um diese mit einem kulturell geprägten Repertoire von Artikulationsformen in Beziehung zu setzen. Insofern sind Emotionen nicht auf physiologische Empfindungen reduzierbar, sondern führen Empfindungen mit komplexen Konzepten zusammen, die diese Empfindungen artikulieren und dabei auch beeinflussen und kanalisieren. In diesen Konzepten manifestieren sich kulturell verankerte Klassifikationen, Interpretationen und Wissensbestände.2
Die besonderen Möglichkeiten einer affektorientierten Aufführungsanalyse werden deutlich, wenn man davon ausgeht, dass Affekte kein individuelles, inneres Geschehen sind, sondern sich in externen Relationen und Konstellationen manifestieren. Tatsächlich nutzen Regisseur*innen etwa die proxemische Dimension der Aufführung, d.h. die variable Positionierung der Akteure im Raum, um affektive Verhältnisse zwischen Figuren zu verdeutlichen (Nähe und Distanz, Anziehung und Abstoßung beispielsweise). Auch räumlich-visuelle und/oder klangliche Atmosphären sind ein wichtiges Mittel, um vielfach diffuse, unklare und uneindeutige affektive Dynamiken darzustellen. Anstatt zu psychologisieren oder über Gefühlszustände zu spekulieren, sollte die Aufführungsanalyse deshalb ihre Chancen nutzen, die in einer genauen Beschreibung von Situationen und Handlungsformen liegen: Wie bzw. in welchem Modus wird eine bestimmte Handlung, etwa ein einfacher Gang über die Bühne, ausgeführt? Welche Situation findet ein Akteur vor, wenn er die Bühne betritt? Wie adressieren die Akteure von der Bühne aus das Publikum? Kann in der Hinwendung zum Publikum ein affektiver Gestus beschrieben werden? Der Begriff des Gestus kann eine Orientierung für affektorientierte Analysen dieser Art geben. Er bezeichnet Haltungen von Akteuren, die sich sowohl kommunikativ als auch körperlich zeigen. Eine an Brecht orientierte Theatertheorie geht davon aus, dass solche Haltungen nie nur von einzelnen Akteuren eingenommen werden, sondern sich zwischen Akteuren entfalten und von sozialen Kontexten abhängen. Aussagen zum Gestus können insofern bei einzelnen Akteuren ansetzen, müssen sich von dort aus aber auf komplexe Situationen und soziale Verhältnisse erstrecken.3 Am Ende solcher Analysen, die – wie jede Aufführungsanalyse – immer weiter verfeinert werden können, steht kein Katalog von Emotionen, die einzelnen Akteuren zugeschrieben werden könnten, sondern die differenzierte Beschreibung einer situativen Konstellation, die den*die Analysierende*n stets mit einschließt.
Читать дальше