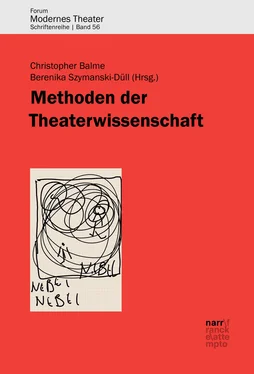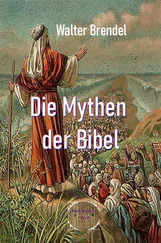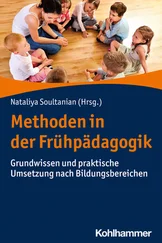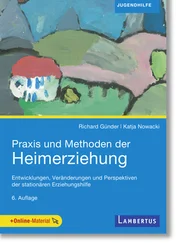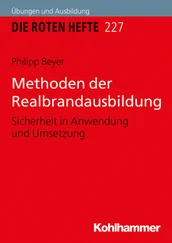Die semiotische Variante fragt danach, wie in Aufführungen Bedeutung hervorgebracht wird. Die Aufführung wird dabei als ein Ensemble heterogener Zeichen aufgefasst, die auf komplexe Weise miteinander korrespondieren und von den Zuschauer*innen decodiert werden müssen. Die Analyse zielt darauf ab, die Zeichenstruktur der Aufführung genau zu erfassen, um dadurch Mechanismen der Bedeutungsproduktion herausarbeiten zu können. Der Blick richtet sich insofern auf die verschiedenen Zeichensysteme des Theaters (darunter das gesprochene Wort, Stimme, Klang, Mimik, Gestik, Proxemik, Raumgestaltung, Kostüme, Maske, Licht u.v.m.) und zugleich auf die erkennbaren Bedeutungseinheiten. Der*die Analysierende versucht zunächst, die Aufführung zu untergliedern (in Sequenzen, Szenen oder kleinere Einheiten), um dann die dominanten und prägenden Zeichenstrukturen ausfindig zu machen und diese auf ihre Bedeutung zu befragen. Es kann sinnvoll sein, einzelne, besonders markante Zeichen oder Zeichenkomplexe herauszugreifen und aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Neben der eigentlichen Bedeutung sind immer auch Konnotationen und Assoziationen von Interesse, so dass feine Nuancen und individuelle Varianten des Verstehens hervortreten können. Es geht weniger um das Fixieren eines ‚Sinns‘ der Aufführung als vielmehr um ein differenziertes Herausarbeiten der vielfältigen Prozesse, in denen Bedeutungen im szenischen Geschehen konstituiert, aber häufig auch wieder destabilisiert werden.4
Die phänomenologische Variante der Aufführungsanalyse ist dagegen mehr an Wirkungen als an Bedeutungen interessiert. Sie fragt nach den Erfahrungen, die in einer Aufführung gemacht werden können. Dabei kommt es entscheidend darauf an, dass der*die Analysierende seine*ihre eigene Aufführungserfahrung genau beschreibt und reflektiert. Zu diesem Zweck wird nach dem Aufführungsbesuch ein so genanntes Erinnerungsprotokoll angefertigt, in dem der*die Wahrnehmende Aspekte oder Momente der Aufführung beschreibt, die besonders nachhaltig auf ihn*sie gewirkt haben. In der Reflexion dieser „markanten Momente“5 stehen nicht Bedeutungen, sondern Erfahrungen im Zentrum, wie sie etwa mit Kategorien wie Klang, Stimme, Rhythmus, Atmosphäre oder Präsenz erfasst werden können.6 Die Subjektivität der entstehenden Beschreibungen wird dabei nicht als Problem empfunden, zumal im Konzept des Phänomens (d.h. des wahrgenommenen oder empfundenen Dings) der*die Wahrnehmende und das Wahrgenommene als untrennbar verschränkt gedacht werden.7 Ähnlich werden etwa Atmosphären aus phänomenologischer Sicht als eine von Wahrnehmenden und Wahrgenommenem gemeinsam konstituierte Erfahrung konzeptualisiert.8 Das Schreiben wird von den Phänomenen inspiriert. Eine phänomenologisch ausgerichtete Aufführungsanalyse setzt weniger auf die Lektüre einzelner Zeichen als auf das ganzheitliche „leibliche Spüren“ von Affektivität.9 Der*die Analysierende soll sich über das eigene Befinden in der Aufführung Rechenschaft ablegen.
In der Praxis werden die beiden Varianten der Aufführungsanalyse heute meist miteinander kombiniert, weil sich theaterwissenschaftliche Studien in aller Regel sowohl für die Bedeutungs- als auch für die Erfahrungsdimension von Aufführungen interessieren. Manche Forscher*innen legen Wert auf einen Unterschied zwischen Aufführungs- und Inszenierungsanalyse:10 Während in der Inszenierungsanalyse die Konzeption des auf der Bühne Gezeigten, das im Probenprozess Erdachte und Erarbeitete im Vordergrund steht, geht es in der Aufführungsanalyse um die Erlebnisse und Deutungen im Hier und Jetzt des einzelnen performativen Ereignisses. Tatsächlich lassen sich aber auch diese beiden Perspektiven in der analytischen Praxis gut miteinander verbinden. Die Wahl des Analyseschwerpunkts hängt nicht zuletzt vom Typus der gewählten Aufführung ab. Handelt es sich um eine Theateraufführung aus dem Feld der Künste, dann richtet sich das Interesse häufig darauf, die Idee der Inszenierung herauszuarbeiten und die von dieser Idee geprägten ästhetischen Mittel differenziert zu erfassen. Ist dagegen eine anders geartete kulturelle Aufführung (z.B. ein Fest, ein Ritual oder eine politische Versammlung) Gegenstand der Analyse, dann mag etwa die Frage nach den Regeln des Handelns oder nach der Agency einzelner Akteure im Vordergrund stehen. Auch die kulturelle Funktion der jeweiligen Aufführung kann als Fluchtpunkt der Analyse dienen.
2. Zur Virulenz des Subjektivismus-Problems
Der eingangs skizzierte Subjektivismus-Vorwurf gegen die Aufführungsanalyse begegnet in jüngerer Zeit dringlicher als zuvor. Diese Virulenz hat auch mit veränderten Forschungsinteressen zu tun. Längst beschränken Theaterwissenschaftler*innen ihre Studien nicht mehr auf die vertrauten Theaterformen der eigenen Region. Mit der verstärkten Globalisierung des Theaterbetriebs (u.a. durch internationale Gastspiele, Tourneen und Festivals) ist Interkulturalität eine allgegenwärtige Dimension in Aufführungen geworden. Es vermehren sich damit auch Erfahrungen des Nicht-Verstehens, mit denen in semiotischen Analysen nicht leicht umzugehen ist: Kann man Zeichenprozesse analysieren, wenn einem der zugrundeliegende Code gar nicht geläufig ist? Inszenierungen des postmigrantischen Theaters, Debatten über Blackfacing, Minstrel Shows und andere kolonial geprägte Darstellungsformen und eben die transkulturelle Öffnung von Gastspielen und Festivals regen zum Nachdenken darüber an, wer aus welcher Perspektive über ein szenisches Geschehen scheiben kann. Die Frage nach der Perspektivgebundenheit bzw. Positionalität des Analysierens stellt sich in ähnlicher Weise sicher auch Kunsthistoriker*innen und Filmwissenschaftler*innen, aber ein spezifisches Problem der Aufführungsanalyse scheint doch daraus zu resultieren, dass Aufführungen anders als Filme oder Bilder ihr Publikum immer schon miteinschließen: Wenn wir über eine Aufführung schreiben, schreiben wir auch über ein Publikum, das integraler Teil dieser Aufführung ist und dessen Mitglied wir wiederum selbst sind – ohne es allerdings repräsentieren zu können. Wie unterscheidet sich die eigene Perspektive von derjenigen anderer Zuschauer*innen? Was ist die eigene Position nicht nur zu , sondern auch in der Aufführung, und wie hebt sie sich von anderen darin etablierten Positionen ab?
Auf dem derzeit stark bearbeiteten Feld von Theater und Migration, in der Beschäftigung mit migrantischem bzw. postmigrantischem Theater (um diese problematischen Bezeichnungen hier einmal als Kürzel zu verwenden) wird oft die Forderung erhoben, in aufführungsanalytischen Texten die eigene Perspektive gründlicher und expliziter zu problematisieren. Es ist meines Erachtens eher nicht die ästhetische Form der betreffenden Aufführungen, die die eigene Perspektive problematisch werden lässt, zumal die verwendeten Formen einerseits ganz unterschiedlich ausfallen können, andererseits oft recht leicht zugänglich sind. Entscheidend für die politische Frage nach der Positionalität des Schreibenden ist vielmehr die Beteiligung von Gruppen, die in die drängenden identitätspolitischen Kämpfe der Gesellschaft verwickelt sind. Beteiligung kann bedeuten, dass die betreffenden Inszenierungen thematisch auf diese Gruppen eingehen; sie kann aber auch darin bestehen, dass Mitglieder dieser Gruppen an der Aufführung mitwirken, sei es als Darsteller*innen oder als Zuschauer*innen. Sobald eine dieser Formen der Beteiligung gegeben ist, wird ein anspruchsvoller Fragenkatalog aufgerufen: Welche sozialen Gruppen konstituieren die Aufführung insgesamt, und welche dieser Gruppen ist in der Lage, die kulturellen Codes zu entschlüsseln, die in die Inszenierung eingegangen sind? An wen richtet sich die Inszenierung, für welche Zielgruppe wurde sie gemacht, bei wem möchte sie etwas bewirken? Wer ist aufgrund welcher biographischer Prägungen in der Lage, die Erfahrungen, die in der Aufführung verhandelt werden, nachzuvollziehen? Welchen Gruppen gibt die Aufführung Raum, welche anderen Gruppen bleiben in ihr unsichtbar? Wie geht eine Inszenierung, die von identitätsbezogenen Ein- und Ausschlüssen handelt, mit den Ein- und Ausschlussmechanismen des Theaters um? Wie man diese Fragen beantwortet, hängt nicht unwesentlich von der sozialen Position ab, auf der man sich selbst befindet. Eine Inszenierung, die identitätspolitische Grenzziehungen problematisiert, fordert die diversen Identitätskonstruktionen der Zuschauer*innen in unterschiedlicher Weise heraus. Welche Identitätskonstruktion organisiert den Blick des*der Analysierenden? Kann und sollte er*sie das offenlegen?
Читать дальше