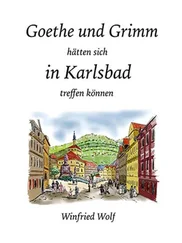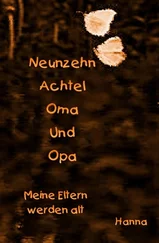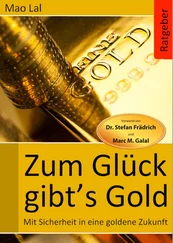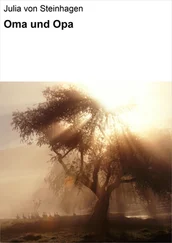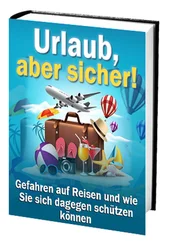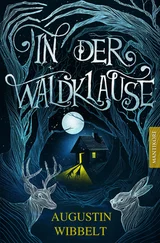Manche werden relativjung zu Großeltern, andere warten dagegen lange und sehnsüchtig auf ein Enkelkind. Die Großelternschaft kann also in ganz unterschiedlichen Lebenszeiten eintreten.
Mit 50 Jahren((oder sogar früher) Großeltern zu werden, fällt für viele Frauen und Männer in die Lebensphase, in der sie noch berufstätig sind, meist in Vollzeit und voller Engagement. Diese Großeltern sind dann die sogenannten »jungen Alten«. Die zentralen Themen in dieser Zeit bestehen darin, die Möglichkeiten und die Grenzen für die Unterstützung der Elternfamilie mit dem Enkelkind auszuloten.
Werden Eltern mit etwa 60 JahrenJahren Großeltern, dann befinden sie sich möglicherweise schon in der Übergangszeit vom Beruf zum Ruhestand. Diese Lebensphase will bewältigt und neu gestaltet werden. Sei es, dass es eine große Erleichterung ist, den Beruf aufzugeben, oder dass es sehr schwerfällt, dies zu tun. Es gilt, das »Unternehmen Zukunft« neu zu gestalten. Durch die Geburt der Enkel kommt es dann zu einer neuen Rolle mit neuen Aufgaben.
Wenn Sie mit 70 JahrenGroßeltern werden, haben Sie sich bereits an Ihr Dasein als Rentner oder Pensionär gewöhnt, und es hat sich meist alles schon gut eingespielt. Körperlich können sich in diesem Alter erste kleinere Einschränkungen einstellen. Doch Untersuchungen haben ergeben, dass Jugendliche oder jüngere Enkel ganz allgemein die Omas und Opas fit halten. Für viele sind die Enkelkinder willkommene neue Familienmitglieder, die intensive emotionale Beziehungen anbieten.
Großeltern sind gegenwärtig mit einigen Veränderungen in unserer postmodernen Gesellschaft konfrontiert. Die Familienformen zeigen eine bunte Vielfalt: So gibt es die traditionelle Ehe (Vater, Mutter, Kinder(er)), es gibt gleichgeschlechtliche Paare und einen sehr hohen Anteil von Paaren, die in einer (eheähnlichen) Lebensgemeinschaft leben. Durch die große Anzahl von Paaren mit Kindern, die sich trennen oder scheiden lassen, gibt es zahlreiche alleinerziehende Eltern oder auch neue Konstellationen wie die sogenannten Patchwork-Familien mit einem biologischen und einem sozialen Elternteil. Die Scheidungsquote (Statistik von 2016) liegt inzwischen bei 46 Prozent, das bedeutet, dass fast jede zweite Ehe geschieden wird. Laut dem Statistischem Bundesamt lag die Quote im Jahr 1960 noch bei zehn Prozent.
Zur Vielfalt heutiger Lebensformen gehören auch alle binationalen Familienverbindungen, also etwa Familien mit einem deutschen und einem ausländischen Elternteil. In diesen Familien treffen verschiedene Kulturen aufeinander. Die Kinder verbinden beide familiären Wurzeln.
Verändert hat sich auch der Anteil von Frauen, die als Mütter wieder berufstätig sind. Es ist inzwischen der Normalfall, dass die Mütter relativ bald nach der Geburt eines Kindes wieder arbeiten, manchmal in Vollzeit, oft in Teilzeit, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können.
Eine weitere gravierende Veränderung, die uns Großeltern besonders betrifft, sind die sich wandelnden Erziehungsformen. Diese entwickelten sich von autoritären über die antiautoritären Strukturen hin zu ausgeprägt partnerschaftlichen Formen. Begriffe wie die Gleichwertigkeit oder Gleichwürdigkeit (diesen Begriff prägte der dänische Familientherapeut Jesper Juul) aller Familienmitglieder, also von den Kindern und den Erwachsenen, sind von zentraler Bedeutung. Ich plädiere in meiner Tätigkeit als Familientherapeutin dafür, dass Kinder ernst genommen werden, wir ihre Grenzen und Integrität achten und sie respektiert müssen.
Die Kinder haben in diesen Familien ganz selbstverständlich eine starke Position. Sie werden früh dazu ermutigt, eigene Meinungen zu äußern und diese angemessen zu vertreten. Somit sind die Enkelkinder anders sozialisiert als frühere Generationen von Kindern. Sie hinterfragen Anweisungen und akzeptieren gesetzte Grenzen nicht einfach, sie wollen Erklärungen. Diese Verhaltensweisen machen es erforderlich, dass Sie als Großeltern sehr klar und authentisch reagieren. Damit stärken Sie Ihre Position und das Selbstwertgefühl der Kinder. In solchen Situationen ist ein konstruktiver Umgang miteinander gefragt; es ist zielführend, wenn die Kinder einbezogen werden.
Dies wirft ein Menge Fragen auf. Sie merken schon, damit Familien- und Generationsbeziehungen gelingen können, müssen Antworten auf viele Fragen gefunden werden!
Zur Zeitgeschichte – was uns prägte
Um die jetzige Großelterngeneration zu verstehen, ist der geschichtliche Kontext wichtig, der sie geprägt hat. Die heutigen Großeltern sind überwiegend in der Nachkriegszeit geboren, einige vielleicht auch noch während des 2. Weltkriegs. Sie haben als Kinder die Kriegs- oder Nachkriegszeit erlebt, eine Zeit, in der das ganze Land und die Gesellschaft im Umbruch waren. Viele Familien haben Not und Flucht oder den Tod von Angehörigen erlebt. Alle heutigen Großeltern hatten Eltern, die vom Krieg gezeichnet waren. Die Jahre bis 1949 waren geprägt von Mangel und Chaos, und die folgenden 50er-Jahre durch Verschleierung und Restauration. In den 60er-Jahren folgte der Versuch eines Neuanfangs, der mit großen gesellschaftlichen Umbrüchen einherging. Um die Ereignisse während des Nationalsozialismus besser verstehen zu können und gleichzeitig auch, um die Verdrängung der Geschehnisse zu verhindern, stellten viele Söhne und Töchter Fragen an ihre Eltern: »Was ist geschehen und was habt ihr während der NS-Zeit getan?« Eine direkte Aufarbeitung der Kriegsgeschehnisse hatte damals noch nicht begonnen. Aus der heutigen Trauma-Forschung wissen wir, dass die Folgen von Traumata regelrecht vererbt werden können, sodass sie auch die nachfolgenden Generationen noch beeinflussen. Viele der heutigen Großeltern hatten Väter und Mütter, die durch ihre Erlebnisse im Krieg traumatisiert wurden (etwa Gefangenschaft, Flucht, Vergewaltigung, Entbehrung und Hunger).
Solche Erfahrungen wirkten in den Familienalltag und führten oft zu elterlichem Verhalten, dass den Kindern unverständlich war. So bestanden zum Beispiel viele Eltern vehement darauf, dass die Kinder ihren Teller leer essen mussten, dabei fehlten Erklärungen und Einfühlungsvermögen gegenüber den Kindern. Wir wissen heute, dass viele von unseren Eltern im Krieg Hunger litten. Doch in der Nachkriegszeit kam es nur selten zu offenen Gespräche über solche Erfahrungen, über die Vergangenheit wurde der Mantel des Schweigens gelegt.
Doch die Generation der heutigen Großeltern sind nicht nur die »Erben« der Kriegsfolgen, sondern auch die Erben des Wirtschaftswunders und des folgenden Wohlstands der Nachkriegszeit. Die junge Generation damals versuchte sich aus der Enge der autoritären Strukturen zu befreien. Sie suchten intensiv nach positiven Veränderungen und erstrebenswerten Zielen, nach Freiheit und Selbstbestimmung. Die Jugend rebellierte, sie wollte Neues wagen und ihr Leben umgestalten. Ein Ziel war es, möglichst schnell aus dem Elternhaus auszuziehen, am liebsten in Wohngemeinschaften oder Kommunen. Die Normen und strengen Vorgaben der Elterngeneration wurde hinterfragt und oft abgelehnt. Die Kinder der Nachkriegskinder wuchsen in einer besonderen, quasi doppelten Realität auf. Sie erkannten und erlebten einen Teil ihres Daseins in der sichtbaren Welt und erspüren den tabuisierten Teil aus der unsichtbaren Welt, mit allen Nöten und Ängsten der Erwachsenen. Dies beschreibt mit vielen Beispielen die Autorin Sabine Bode in ihren Büchern über die Nachkriegszeit. 2
Trotz vieler ähnlicher Erfahrungen einer ganzen Altersgruppe, die bestimmend für diese Generation waren, sind die individuellen Schicksale und die Verarbeitung bei den einzelnen Menschen ganz unterschiedlich. Die einen versuchten sich in freier und wechselnder Wahl der Partnerinnen oder Partner, andere gründeten ganz traditionell eine Familie. Von den Erziehungsvorstellungen der Eltern distanzierten sich damals die meisten jungen Eltern und probierten stattdessen für ihre Kinder die antiautoritäre Erziehungshaltung und alternative Kinderläden aus. Ein neues Lebensgefühl entwickelte sich, es war die Zeit der Studentenbewegungen, der Entstehung einer Popkultur und vor allem die Zeit der Revolte gegen alle Konfessionen und generell Althergebrachtes.
Читать дальше