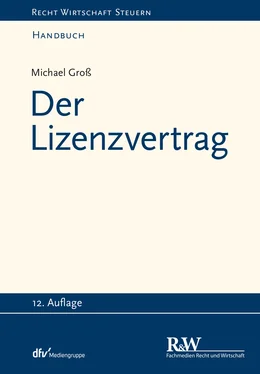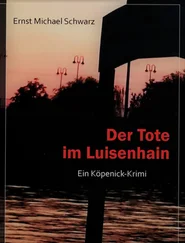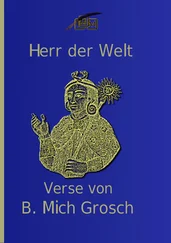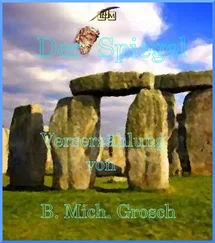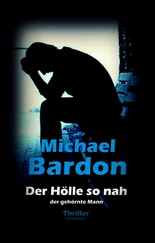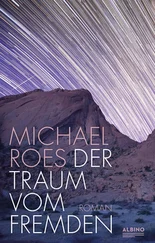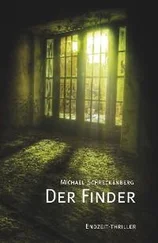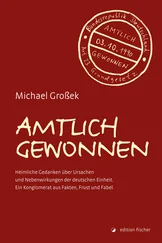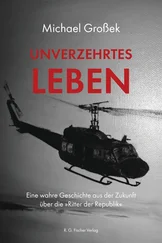III. Nichtigkeit von Lizenzverträgen
50
Selbst wenn sich die Vertragspartner einig sind und einen entsprechenden Vertrag geschlossen haben, kann die getroffene Vereinbarung nichtig sein. Nichtigkeit liegt insbesondere vor, wenn der Vertrag gegen die guten Sitten12 oder gegen ein gesetzliches Verbot13 verstößt. Auf die Fälle, in denen das Geschäft nichtig ist, weil ein Vertragspartner geschäftsunfähig ist, braucht hier – als vor allem theoretischer Sonderfall – nicht weiter eingegangen zu werden.
1. Verstoß gegen die guten Sitten
51
Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt bei Wuchergeschäften vor.14 Zu denken ist hierbei vor allem daran, dass ein Lizenznehmer die Notlage eines Erfinders ausnutzt und sich ein Lizenzrecht gegen eine unangemessen niedrige Gebühr einräumen lässt, oder daran, dass der Lizenzgeber eine Monopolstellung in unzulässiger Weise ausnutzt, um unangemessen hohe Lizenzgebühren zu erhalten. Dabei erfordert die Anwendung der Vorschrift des § 138 BGB allerdings nicht einen kaufmännisch ungünstigen Vertrag, sondern ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn eine neue Erfindung große Vorteile mit sich bringt, so dass andere Firmen mit ihren Erzeugnissen nicht mehr konkurrenzfähig sind, wenn sie nicht das Recht zur Benutzung der neuen Erfindung erhalten. In einem Fall, der dem Reichsgericht zur Entscheidung vorlag, hatten die Vertragspartner einen Lizenzvertrag über eine Erfindung, die zum Patent angemeldet war, geschlossen. Sie gingen dabei davon aus, dass das Patent nicht erteilt werde. Entgegen dieser Annahme erfolgte jedoch eine Erteilung des Patents. Das Gericht vertrat die Ansicht, dass kein Verstoß gegen die guten Sitten vorliege und der Vertrag wirksam sei.15
In einer anderen Entscheidung des RG wurde Nichtigkeit eines Lizenzvertrages wegen Verstoßes gegen die guten Sitten angenommen. Dieser Vertrag bezog sich auf ein erschlichenes Patent, dem Lizenznehmer war diese Tatsache auch bekannt.16 Ausdrücklich ausgenommen wird allerdings der Fall, dass der Lizenznehmer trotz Kenntnis der Patenterschleichung wegen des formellen Bestandes des Schutzrechtes einen Ausnutzungsvertrag für berechtigt gehalten hat.
2. Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot
52
Als gesetzliche Verbote sind vor allem die kartellrechtlichen Vorschriften zu beachten.17 Hierbei ist bei jedem Lizenzvertrag mit besonderer Aufmerksamkeit zu prüfen, ob ein Verstoß gegen die Vorschriften des nationalen Kartellrechtes oder auch z.B. ein Verstoß gegen das EG-Kartellrecht gegeben ist.
Insbesondere im Bereich des EG-Kartellrechtes ergibt sich dabei das Problem extensiv auslegbarer Regelungen, das zu einer nicht unerheblichen Unsicherheit über die Vereinbarkeit gewisser – z.T. typischer – Regelungen in Lizenzverträgen mit dem EG-Kartellrecht geführt hat, unbeschadet der Versuche der EG-Kommission, durch entsprechende Bekanntmachungen eine gewisse Klarheit zu schaffen.18
53
Konsequenz eines Verstoßes gegen das Kartellrecht ist die teilweise oder vollständige Nichtigkeit eines Lizenzvertrages wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot. Weitere Verstöße gegen gesetzliche Verbote können sich im Übrigen vor allen Dingen bei internationalen Lizenzverträgen aus zwingenden Normen der jeweiligen nationalen Rechtsordnungen der Vertragspartner, insbesondere auch aus Genehmigungsvorbehalten staatlicher Stellen, ergeben.19
3. Nichtigkeit bei einer ursprünglich unmöglichen Leistung
54
Ein Lizenzvertrag ist weiterhin nichtig, wenn er auf eine ursprünglich unmögliche Leistung gerichtet ist. Diese Fragestellung soll jedoch im Folgenden im Zusammenhang mit dem Bereich „Unmöglichkeit der Leistung“ dargestellt werden.
12§ 138 BGB. 13§ 134 BGB. 14§ 138 Abs. 2 BGB. 15RG, 28.5.1936, GRUR 1937, 380. 16RG, 25.3.1933, RGZ 140, 185. 17Vgl. dazu unter Rn. 537 ff., 582 ff. 18Wie vor. 19Vgl. dazu Grützmacher/Laier/May, passim.
IV. Unmöglichkeit der Leistung
1. Ursprüngliche Unmöglichkeit und ursprüngliches Unvermögen
a) Rechtslage vor dem 1.1.2002
55
Vor der Schuldrechtsreform (1.1.2002) lag ursprüngliche Unmöglichkeit der Leistung vor, wenn die Leistung tatsächlich schon zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht erbracht werden konnte.20 Unmöglichkeit der Leistung war jedoch nicht dann schon gegeben, wenn die Leistung zwar vom Vertragspartner nicht erbracht werden konnte, sachlich aber möglich war. Voraussetzung für das Vorliegen einer ursprünglichen Unmöglichkeit war daher, dass der zugesicherte technische Erfolg schlechthin unerreichbar war, d.h. die versprochene Leistung aus rechtlichen oder aus tatsächlichen – technischen oder naturgesetzlichen – Gründen als schlechthin unmöglich angesehen werden musste.21 War der Lizenzgegenstand technisch ausführbar, also mit den der Technik zur Verfügung stehenden Mitteln herstellbar, lag eine anfängliche Unmöglichkeit im Sinne der Vorschrift des § 306 BGB a.F. nicht vor.22 Anfängliche Unmöglichkeit war daher gegeben, wenn sich eine lizenzierte Erfindung als nicht ausführbar, nicht schutzfähig oder von einem anderen Patent als abhängig erwies.
56
Allerdings hatte das Reichsgericht hinsichtlich eines Geheimverfahrens zur Herstellung eines Mittels zur Vernichtung von Insekten ausgeführt, dass eine von Anfang an unmögliche Leistung vorliege, wenn mit dem Verfahren ein solches Mittel überhaupt nicht herzustellen ist.23 Isay 24 hielt diese Entscheidung für unrichtig; Rasch 25 schloss sich dieser Auffassung an. Beide sahen hierin einen Mangel der Erfindung, für den der Lizenzgeber einzustehen hat, und nicht einen Fall der ursprünglichen Unmöglichkeit. Dem war zuzustimmen.26
57
Als weiteres Beispiel sei auch ein Urteil des Reichsgerichts erwähnt.27 Es handelte sich hierbei darum, dass eine Lizenz an drei Uhr-Patenten erteilt wurde, die jeden Wettbewerb anderer mit solchen Uhren ausschließen sollte. Weil aber der Gedanke einer solchen Uhr nicht neu war, bezogen sich die Patente nur auf Einzelheiten der Konstruktion. Der Lizenznehmer konnte also die versprochene Leistung nicht erhalten. Das Reichsgericht sah hierin einen nichtigen Vertrag, weil er auf eine von vornherein unmögliche Leistung gerichtet war. Dagegen hat der BGH ausgesprochen, dass die Möglichkeit oder auch naheliegende Wahrscheinlichkeit, dass ein Patent auf eine Nichtigkeitsklage hin für nichtig erklärt wird, nicht genügt, um einen Lizenzvertrag als auf eine unmögliche Leistung gerichtet und damit als nichtig anzusehen.28
58
Das Reichsgericht führte zur Frage der Nichtigkeit aus: „Greift ein zur ausschließlichen Verwertung überlassenes Geheimverfahren so unmittelbar in ein bei Vertragsschluss bestehendes Patent ein, dass es dadurch bereits in vollem Umfang bekannt ist, so wird in der Regel Nichtigkeit des Vertrages nach § 306 BGB a.F. anzunehmen sein, weil dem Lizenzgeber die Erfüllung seines Versprechens, dem Erwerber ein Geheimverfahren zur ausschließlichen Benutzung zu verschaffen, wegen des Neuheitsmangels sachlich unmöglich ist.“29 Dieses Urteil des RG zeigte deutlich den entscheidenden Gesichtspunkt: die sachliche Unmöglichkeit der Bestellung dieses Rechtes.30
59
Das Reichsgericht hatte daher ursprüngliche Unmöglichkeit im Sinne des § 306 BGB a.F. in den Fällen angenommen, in denen die Schutzfähigkeit des zur Nutzung überlassenen Ausschließlichkeitsrechtes von vornherein absolut ausgeschlossen war.31 Die Anwendung des § 306 BGB a.F. wurde z.B. bejaht, wenn ein Lizenzvertrag über den Zeitablauf des Patentes hinaus32 oder über ein rechtlich nicht schutzfähiges Muster33 abgeschlossen wurde. Das Reichsgericht hielt auch einen Lizenzvertrag für nichtig, weil der Lizenzgeber in fahrlässiger Auslegung des Schutzumfangs seines Patents eine Lizenz für einen Gliederkessel ohne Sturzfeuerung einräumte, obwohl das dem Lizenzgeber erteilte Patent nicht so weit reichte und daher für den Lizenzgegenstand kein Schutzrecht bestand.34 Von der Literatur wurde jedoch dieses Urteil angegriffen.35 Rasch nahm Nichtigkeit nur an, wenn die Parteien einen Schutzumfang zugrunde gelegt haben, der nicht bestanden hatte, die übrigen interessierten Kreise den beanspruchten Schutzumfang jedoch nicht anerkannt hatten. Lag nicht nur eine persönliche Vorstellung der Parteien vor, sondern eine allgemeine irrtümliche Auffassung der beteiligten Wirtschaftskreise, so sollte der Lizenznehmer nur mit Wirkung für die Zukunft kündigen können. Das Reichsgericht selbst hatte in einer weiteren Entscheidung36 ebenfalls eine andere Auffassung vertreten.37
Читать дальше