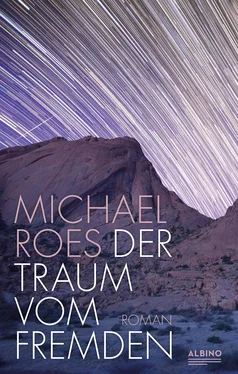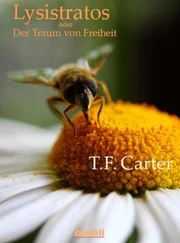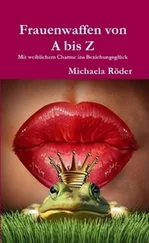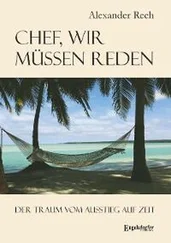DER TRAUM VOM FREMDEN

A. Rimbauds
MICHAEL ROES
DER TRAUM VOM FREMDEN
ROMAN

1. Auflage
© 2021 Albino Verlag, Berlin
Salzgeber Buchverlage GmbH
Prinzessinnenstraße 29, 10969 Berlin
info@albino-verlag.de
Arthur Rimbauds Originalbericht «Rapport sur l’Ogadine»
folgt der Textfassung: Œuvres complètes , Bibliothèque de
la Pléiade, Gallimard, Paris 1963.
Umschlaggestaltung: Johann Peter Werth
Umschlagabbildung: stocksy.com/ Juno
Foto auf Seite 2: Arthur Rimbaud in Harar, etwa 1883
Satz: Robert Schulze
Printed in the Czech Republic
ISBN 978-3-86300-323-4
Mehr über unsere Bücher und Autor*innen:
www.albino-verlag.de
CAHIER I
CAHIER II
CAHIER III
CAHIER IV
CAHIER V
CAHIER VI
ANHANG:
RAPPORT SUR L’OGADINE PAR M. ARTHUR RIMBAUD
MITTWOCH, DEN 3. OKTOBER 1883, EINE HALBE TAGESREISE SÜDÖSTLICH VON HARAR
Aufbruch um sechs Uhr morgens. Wir verlassen Harar durch das südöstliche Stadttor, das Bab as-Salam (das Friedenstor). Neunundneunzig Moscheen, neun mal neunundneunzig Heiligenschreine ( Qubbas ), fünf Stadttore, eine fast viertausend Schritte lange Mauer, unser Kontor am zentralen Platz, dem Pferdemarkt ( Faraz Megala ): als ich vor drei Jahren herkam, war ich der einzige Franzose in Harar, und viele Hararis hielten mich gewiß für einen Spion, zumal ich sofort begann, mit Djamis Hilfe die lokalen Sprachen Amhari und Oromo zu erlernen. Mit dem Arabischen war ich bereits von Aden her vertraut.
In Harar gibt es keinen Konsul, keine Post, keine gepflasterten Straßen; man reist mit dem Maultier oder Kamel dorthin und hat fast ausschließlich Umgang mit Einheimischen. Aber hier fühle ich mich unerwartet frei, und das Klima ist im Vergleich mit Aden das eines Luftkurortes.
Unsere erste Etappe ist nach Landessitte eine nur kurze: Wenn jemand hier eine Reise beginnt, will er die Gunst des Himmels nicht schon mit einem zu forschen Aufbruch herausfordern. Es muß die Möglichkeit geben, es sich doch noch mal anders zu überlegen und umkehren zu können; obgleich wir diese Wahl nicht haben! – Al-Hamdulillah , Gott sei Preis und Dank, wir erreichen Kereyu ohne irgendwelche Zwischenfälle zu al-Fikr , dem Nachmittagsgebet, nach etwa vierstündigem Ritt: so bleibt noch ausreichend Restlicht für den Beginn meines Reisejournals.
Laufe Gefahr, mein Wort zu brechen und mich selbst zu verraten. Hatte ich nicht geschworen: Keine leeren Worte mehr! Überhaupt keine Worte mehr! Am besten verstummen; Taubstummensprache für die notwendigen Mitteilungen, Gesten, Gebärden – wie jeder Laut Übelkeit in mir hervorruft, ein ganzer Satz mich zum Erbrechen bringt und ein Gedicht – ein Gedicht ist der Tod! Warum schweigst du dann nicht? Ein anderer schreibt, denkt, murmelt vor sich hin; in sich hinein – laß ihn doch, wen kümmert’s: unverständliches Zeug, es hört doch ohnehin niemand zu! – Außerdem, wer spricht hier schon meine Sprache, spricht mein Schweigen – niemand kennt mich hier; niemand weiß, wer oder woher ich bin; ich könnte jeder sein. Ist das nicht die Freiheit, die Hölle, die ich gesucht habe? jeder und niemand, ohne Familie, ohne Heimat oder Herkunft, ein Vagabund, Brigant, ein Wegelagerer, Halsabschneider, Meuchelmörder – Ach, übertreib nicht, Junge! Das Wort kennt mich nicht und liebt mich nicht. Schau dich doch an, Engel, Dämon, Unsterblicher, es hat keinen Körper; und nur er ist wahr!
Als Kind leide ich jahrelang unter furchtbaren Kopfschmerzen. Man glaubt mir nicht; unterstellt, ich wolle mich nur vor der Arbeit drücken: bis Doktor Z. mir schließlich den Kopf aufsägt und unter meinem Schädeldach die Föten meiner ungeborenen Geschwister findet. Doktor Z. operiert mich ohne Betäubung; versichert mir, das Gehirn selbst empfinde keinen Schmerz – ich solle während der ganzen Prozedur meine Augen geschlossen halten: weil der Anblick von Messer und Säge schrecklicher sei als das, was sie in Wirklichkeit anrichteten – aber natürlich luge ich durch die nur halbgeschlossenen Lider. Ich wundere mich, wie wenig Blut fließt.
Als Doktor Z. meinen nun von den mumifizierten Föten gereinigten Schädel wieder zusammengeflickt hat, kann ich mich nicht bewegen; nicht einmal die Augenlider. Von der Welt sehe ich nur noch einen schmalen, gräulichen Streifen bei Tage; doch mein Gehör ist um so empfindsamer – das Weinen meiner Schwestern will mir nicht mehr aus dem Kopf. Da ist wohl nichts mehr zu machen: sagt Doktor Z. nach einigen Tagen – oder sind es Wochen, Monate: Ich befürchte, Ihr Sohn wird nicht mehr erwachen; sein Gehirn ist bereits tot, wir sollten auch sein Herz erlösen. – Noch sträubt sich die Päpstin, ich schreie in meinem Körper, schlage mit meinen Fäusten gegen seine tauben Wände – mag sein, die Päpstin spürt etwas davon, auch wenn nichts durch die dicken Mauern der Paralyse nach außen dringt: Am Ende aber muß sie dem Arzt recht geben: Hier quält sich ein Herz vergeblich, zweifellos ist es besser, es endlich zur Ruhe kommen zu lassen.
Bevor Doktor Z. meinen Leib zur Bestattung freigibt, will er noch einen wissenschaftlichen Blick in ihn hineinwerfen: Er schneidet ihn von der Kehle bis zur Scham der Länge nach auf, dann zieht er das Messer von der linken bis zur rechten Schulter, damit er die großen Hautlappen über Brust und Bauch bequem aufklappen kann; daraufhin sägt er das Brustbein auf und reißt die Rippen mit zwei kräftigen Zangen auseinander – mit blutigen Händen schneidet er mir ein Organ nach dem anderen aus dem Leib: Leber Magen Nieren Milz, wiegt sie sorgfältig, untersucht ihren Inhalt, lächelt oder seufzt gelegentlich, hantiert überwiegend aber mit großem dokumentarischen Ernst. Und spart sich das noch zuckende und doch so vergeblich schlagende Herz bis zum Schluß auf: Das sieht doch alles verdammt gesund aus, murmelt er; es muß wohl allein der Kopf sein, der hier versagt hat! Dann stopft er – eher achtlos – die Innereien wieder in ihre Körperhöhlen, vernäht die Hautlappen mit einigen groben Stichen, damit der Leib wenigstens bis zur Grablegung einigermaßen zusammenhält, und denkt dabei schon über den Artikel für das medizinische Fachblatt nach, den er noch heute abend beginnen wird. Im übrigen ist der Friedhof meines Heimatstädtchens ja so feucht und reich an Ungeziefer, daß ein frischer Kadaver kaum zwei Wochen braucht, um bis auf die Knochen und ein paar nutzloser Zähne verwest zu sein: Im Grunde könne er da ja schreiben, was er wolle.
Die Fernen in Charleville wollen, da sie mich nun im Besitz eines photographischen Apparates wissen, ein Bild von mir. Doch ich scheue nicht nur den Aufwand und die unnötigen Kosten: Ich bin hier in den Augen der wenigen Europäer wohl schlecht gekleidet, trage immer nur leichtes Baumwollzeug, das man andernorts für die Lumpen eines Vagabunden halten könnte. Die Kälte eines Ardennenwinters könnte ich wohl kaum noch ertragen. Aber würde ich denn überhaupt noch, und sei es auch nur für einen Besuch, in jenes kalte Land zurückkehren wollen?
Auch hier in den Bergen um Harar ist es in den Wintermonaten regnerisch und kalt; trotzdem trage ich aus Gewohnheit nur eine einfache Tuchhose und das hier übliche weite Hemd: daher vielleicht die arthritischen Beschwerden; manchmal trifft es mich wie ein Hammerschlag unter der rechten Kniescheibe, dann fällt das Gehen mir schwer, als sei das Gelenk vollkommen ausgetrocknet und statt mit einem gleitenden Mittel mit Sand geschmiert. Alles geht nunmehr ein wenig langsamer voran, ich hoffe, Sotiro wird es mir verzeihen. Aber das muß ja nicht zum Schaden dieses Unternehmens sein, meist ist es in diesem Land ja die Ungeduld, die den Eiligen ins Verderben stürzt!
Читать дальше