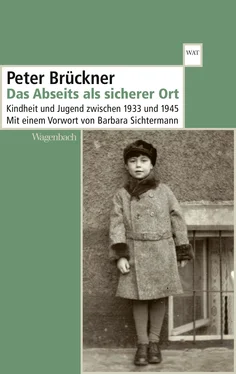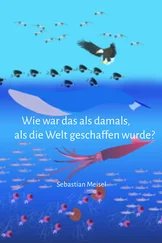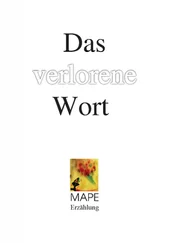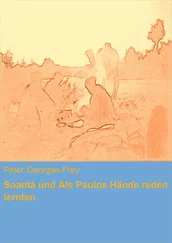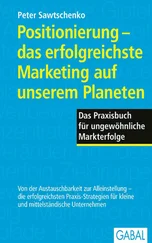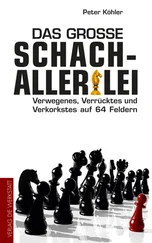So machte ich Gebrauch von einer Möglichkeit, die es immerhin gab, obwohl in meinem Erfahrungsumfeld kaum jemals genutzt: die Teilnahme am kirchlichen Zeremoniell in Jungvolk-Uniform. Für mich war dies die Fortsetzung des »Kriegs« gegen die Normalität. Ich wurde auf paradoxe Weise im Abseits konfirmiert, nämlich unter dem Hakenkreuz, und an gewissen Stellen des Rituals, wo man sich eigentlich verbeugen sollte, schlug ich die Hacken zusammen wie ein Soldat – eine Abwandlung der Zeremonie, die nirgends vorgesehen war, aber die Logik faschistischer Formen für sich gehabt hat. Es war, bei Licht betrachtet, Lebenspfusch. Mein Vater war nicht gerade glücklich. Gewiß: Pfarrer, Öffentlichkeit und Ritual mußten es sich bieten lassen, daß einer den Bruch mit ihren Traditionen ausdrückte, während er sich ihren Riten unterzog; Traditionen, die leer genug waren, so daß es ihnen recht geschah. Ich hatte aber die Form gewählt, in der Faschisten mit Traditionen brechen. Ich wählte ihre Uniform als Mittel meines Protests, doch es war ihre Verkehrsform, die sich zum Inhalt meines Protests gemacht hatte.
Ich war am Ende selbst nicht glücklich damit. Es war nicht Scham, was ich empfand, eher ein Verlust von Identität. Das ist ein Niveau, auf dem es sich mit der Lüge schlecht lebt, und ich lebte gern. Ein Vierzehn- oder Fünfzehnjähriger, der hinterher Kaffee und Kuchen genießt »und nicht mehr daran denkt«, denkt sehr wohl lange daran. Was ist denn Mut? Was ich da bewiesen hatte, war keiner. Ich empfand, was ich erst sehr viel später auch ausdrücken konnte: Mut ist die Gesinnung der Freiheit, und das Ergebnis von Freiheit überwältigt den Mutigen, weil es ihn überrascht – es ist nämlich Glück . Ich war aber unglücklich. Jedenfalls wurde die Konfirmation für mich in der Tat das, was sie ihrem kirchlichen Sinne nach einst für den Gläubigen markiert hat: ein Wendepunkt.
In den ersten Sommerferien der Internatszeit ging ich auf große Fahrt , das heißt ich nahm am Zeltlager des Jungvolks (HJ) teil, mit Angst und mit kühnen Erwartungen.
Fürs erste war die »große Fahrt« wohl glaubhaft: Mit der Eisenbahn als bewimpeltem Schiff fuhren wir länger als einen Tag nach Birkenfeld im Hunsrück, also in die Pfalz, für einen sächsischen Jungen sehr weit weg. Danach ein Zeltlager im dörflichen Gelände.
Am zweiten oder dritten Tag schon stand ich am hölzernen Schlagbaum, der das Lager abschloß, in gehöriger Entfernung von der Wache, und sah sehnsüchtig nach den Waldstücken »im Tal«. Es war aber kein Tal da, unser Lagerplatz befand sich auf einer leicht gewölbten Ebene, es sollte nach meinen Erwartungen eins sein:
»Jenseits des Tales standen unsere Zelte,
vor’m roten Abendhimmel quoll der Rauch«,
war eines meiner Lieblingslieder, vor allem zweistimmig gesungen, doch auch in meiner literarisch geprägten Phantasiewelt war »Tal« eine Chiffre für das trunkene Verhältnis zur Natur. Das Draußen, von dem der lyrische Sog ausging, war betretbar entweder als Exerzierplatz oder als Ort für laute Spiele, und beidem konnte man sich kaum entziehen. So blieb mir von den Erwartungen der »großen Fahrt« wenig – der Abend am Lagerfeuer und die Nacht. Aber nur der Wachdienst durfte das Zelt für ein oder zwei Stunden verlassen, wenn der Himmel voller Sterne war oder sich im Osten schon erhellte.
Der Dienst bestand zu großen Teilen darin, praktische Bedingungen des Lagerlebens zu garantieren (also für Essen, Trinken, Sauberkeit zu sorgen), dazwischen oder danach: »Schulung«, Spiele, ein Wettkampf; manchmal ein Ausmarsch ins Gelände. Wir hatten auch Freizeit, aber man verbrachte sie im Lager. Erst am sechsten oder siebenten Tag durften wir alle ins Dorf, sahen in Bauerngärten und -häuser, kauften uns was. Bei dieser Gelegenheit verdarben sich einige von uns den Magen, wahrscheinlich am Speiseeis – ich leider nicht. Es gab zwar Fieber und Durchfälle, aber auch den vorgeschriebenen Besuch beim Arzt, der die Erkrankten aus dem Lager entließ: sie wurden nicht nur vom Dienst freigestellt, sondern bei Bauern »privat« untergebracht.
An diesem sechsten oder siebenten Tag hätte ich das Steinhaus dem Zelt schon vorgezogen, die Lust an bewimpelter Fahrt war verraucht. Ich wäre gern allein gewesen. Und in der Stadt hatte ich mich viel besser zurechtgefunden als zwischen Sträuchern und Zelten. Was tun? Sich krank melden? Ich war nicht krank. Einen guten Tag zögerte ich, weil ich meinte, der »Führer vom Dienst« (der für Krankmeldungen zuständig war) würde mir meine schlechten Absichten ansehen können, aber dann faßte ich mir ein Herz. Zu meiner Erleichterung handelte der zunächst telefonisch verständigte Arzt kurz und knapp. Ohne Umstände – und ohne Untersuchung – empfahl er meine Verlegung in ein Bauernhaus. Da saßen wir nun, zu zweit oder zu dritt, und redeten mit den Bauernkindern, die uns neugierig besuchten. Mit Befriedigung hörte ich von einem Führer, der gelegentlich nach den Kranken sah, was wir versäumten: unsere Kameraden erwarben anscheinend ein Sport- oder Leistungsabzeichen – Sprung, Wurf, Wettlauf, Bodenturnen, Übungen im Gelände, sie lernten, wie man mit Kompaß und Landkarte umgeht. In unserem »Abseits« gab es Abenteuer-Bücher aus der Schulbibliothek, und unter den Besuchern ein Mädchen, in das ich mich heftig verliebte. Ich weiß ihren Namen und ihren Geburtstag noch, ja, ich erinnere mich sogar an das Haus, in dem sie wohnte: als acht oder zehn Tage später die »große Fahrt« glücklich vorbei war und die »Kranken« sich pünktlich am Bahnhof einzufinden hatten, lief ich dort rasch noch einmal vorbei; sie sah aus dem Fenster. 8
An einem Zeltlager der HJ habe ich nie wieder teilgenommen, sooft ich in den Ferien auch unterwegs war. Die Disziplinarordnung der Hitlerjugend enthielt einen lästigen Paragraphen: »Fahrten ohne Uniform, auch als Einzelwanderer, sind unzulässig« 9, und mit Uniform war die Einzelwanderung erst verpönt, dann verboten.
Anfangs wußte ich davon nichts, welcher Junge liest eine Disziplinarordnung? Später kümmerte ich mich nicht darum, weil es keine organisierten Kontrollen gab, und als 1938 ein »Streifendienst« dafür eingerichtet wurde, fand ich einen Ausweg. 10
Ein Mittelgebirge, das »Erzgebirge«, bildet die Ostgrenze Sachsens zur Tschechoslowakei; für ein Dresdener Stadtkind: Wälder, Pilze, holzgefertigtes Spielzeug und Volkslieder im Dialekt. Im Winter nahm man seinen Rodelschlitten mit. Wo die Ebene unweit von Chemnitz (heute »Karl-Marx-Stadt«) ins Gebirge übergeht, lebte ein Onkel meines Vaters, ein evangelischer Landpfarrer. Das Pfarrhaus roch, wie in vielen deutschen Lebenserinnerungen, nach Fröhlichkeit, Holz, Äpfeln und Tabak. Ich hatte als Kind dort abenteuerliche Ferien verbracht, aber das war lange her – zwei, drei Jahre.
Inzwischen war die Grenze zur Tschechei »politisiert«. Im Schullandheim wurde ich mit der Geschichte der deutschstämmigen Minderheiten des Nachbarlandes gelangweilt. »Wehe dem Volk, dessen Grenzländer nicht mehr so dicht besiedelt sind, daß ein dichter Wall von Menschenleibern dem Bevölkerungsdruck eines wachsenden Nachbarstaats standhalten kann!«, hieß es in unserem Geographiebuch. Bei den Friseuren im Dorf konnte man Zigaretten stückweise kaufen, darunter die tschechische Vlasta , für anderthalb Pfennige.
1937 wurden mein Vater und ich eingeladen, die Weihnachtstage »im Kreise der Familie« jenes Onkels zu verbringen. In dieser Phrase verflochten sich Mitgefühl und Kritik. Für die Gewohnheiten des geistlichen Mittelstands war jede Auflösung der Familie, die anders als durch den Tod entstand, Anlaß zur Sorge, das heißt: sie mißfiel. Den NS-Staat verdächtigte man der Familienfeindlichkeit, weil er Kinder gegen ihre Eltern einnahm und familiäre Beziehungen, begründet auf Sitte und göttliches Gebot, politisierte. Bewegte sich eine Mutter, die aus politischen Gründen Land, Mann und Kind verließ, nicht im selben Dunstkreis? Mitgefühl, ja, aber als »absprechende Liebe«.
Читать дальше