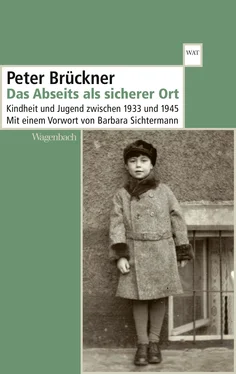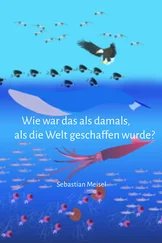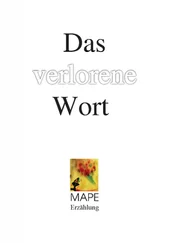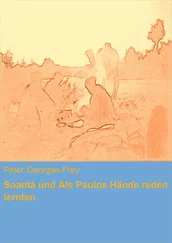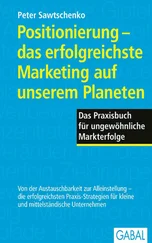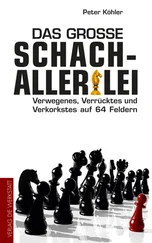Mein (Halb-)Bruder Frank verdiente sich Geld für das Studium am Konservatorium in der »Mücke« im Großen Garten, einem Tanzcafé von Ruf. Ab und an, wenn meine Mutter mit ihrer Kapelle auf Reisen war, klingelte mich seine Freundin Ellen, eine Norwegerin, spätabends aus dem Bett und nahm mich mit. Ich war damals zwölf. Das waren große Abende: unter Palmenkübeln, an einem reservierten Tisch, der den Musikern und ihren Bräuten vorbehalten war! Sooft ich durfte, besuchte ich Frank nachmittags in seinem möblierten Zimmer, während er Mozart spielte oder Hindemith. Er begleitete damals eine Sopranistin, die die »Marienlieder« sang. Doch Ende des Jahres 1934 reiste er nach Schweden und blieb dort. Er hatte sich nach einem Zusammenstoß mit der Polizei rasch zur Emigration entschlossen.
Da war vieles für mich vorbei; besonders schmerzlich: auch an Vertrauen. Man weiht ein Kind nicht in Pläne zur Auswanderung ein, es stand zu viel auf dem Spiel. Es wird zeitig genug merken … Ja, eines Tages merkte ich, daß Frank, und damit eine Fülle von Erlebnissen, für immer fehlen würden. Ellen kehrte nach Oslo zurück; auch von einer zweiten Freundin meines Bruders, Mercedes, blieb nur eine Schale voll Bisquits.
Vorbei war auch die Oberrealschule Seevorstadt: Ich konnte aus finanziellen Gründen auf der Höheren Schule nicht bleiben. Ostern 1934 kehrte ich in die Volksschule zurück, der bloße Terror. Je häufiger ich allein war, um so gründlicher entzog ich mich ihm. Mein Vater brachte mich schließlich als – beaufsichtigter – Untermieter bei verschiedenen armen Leuten billig unter, aber das hielt immer nur eine Zeit. Ich weinte, war aber unbezähmbar. Nach Zwischenaufenthalten bei Verwandten meines Vaters floh ich im Sommer 1935 in die meist leere elterliche Wohnung zurück: versorgte mich selbst, kaufte ein, ging kaum zur Schule, fraß das Leben der Stadt mit Augen, Ohren und Nase, lief in Kirchenkonzerte (der Eintritt war damals meistens frei). In den Nächten, wenn ich sie nicht auf dem Bahnhof verbrachte, las ich, was immer mir in die Hände fiel: anarchische Lust des »Abseits«. Es war die uns versprochene Freiheit der großen Stadt, die ein Zwölf- und Dreizehnjähriger sehr wohl als Quelle von Identität und Glück zu nutzen versteht, solange man ihn in Ruhe läßt.
Im Winter 1935 war die Ruhe vorbei, Polizei und städtisches Wohlfahrtsamt kamen dazwischen. Ich galt als »verwahrlosungsgefährdet«, Fürsorgeerziehung wurde angedroht. Die Ordnungsmacht kam nicht aus eigenem Entschluß, jemand hatte sie gerufen, ein »Jemand« im Plural. Meine Mutter gehörte dazu, zögernd, aber eben doch, sie fühlte sich auf der Suche nach einer neuen Lebensweise und -organisation von mir bedroht. Sie steckte damals mit einem tschechisch-jüdischen Kapellmeister unter einer Decke, der auch eine Überlebens- und Emigrationschance suchte; das Auswandern kostete Geld. Er stiftete meine Mutter an, eine seltene Sammlung alter südamerikanischer Briefmarken zu verkaufen, ein Erbstück aus den USA, von der ich meinte, sie gehöre mir. Eifersüchtig und tief verletzt brach ich in den Schreibtisch unseres Untermieters ein, in dem, wie ich wußte, eine Schußwaffe lag. Ich verbarg sie unter meinem Kopfkissen; dazu bereit, auf jemanden zu schießen – auf »sie« oder auf »ihn«. Die Sache kam natürlich heraus, der Untermieter lief zur Polizei, Nachbarn meldeten ihre Beobachtungen, und so gab es ein großes Spektakel.
Mein Vater kam und gab bei der Jugendfürsorge zu Protokoll, daß er ein Internat für mich gefunden habe. Ich wußte nicht, daß zu der Suche danach auch der Entschluß meiner Mutter beigetragen hatte, sobald als möglich zu emigrieren.
Im Frühjahr 1936 verließ ich Dresden, aufgenommen in eine Oberschule mit Schülerheim in Zwickau, einer kleinen Bergwerks- und Industriestadt in Westsachsen. Wenige Monate später kehrte meine Mutter für immer nach England zurück. Auf ihrer Frisierkommode stand noch jahrelang ein kleiner Bilderrahmen ohne Bild – er hatte früher eine in Kunstschrift gehaltene Karte mit ihrem Goethe’schen Lieblingsspruch enthalten:
»Feiger Gedanken / Bängliches Schwanken
Weibisches Zagen / Ängstliches Klagen
Wendet kein Elend / Macht dich nicht frei.
Allen Gewalten / Zum Trutz sich erhalten
Nimmer sich beugen / Kräftig sich zeigen
Rufet die Arme / Der Götter herbei«
Die Bedingungen, unter denen ich meine Mutter fast zwölf Jahre später wiedersah, sind für den Geist der Zeit, das heißt für den transzendentalen Rahmen unser aller Existenz bezeichnend: es waren Bedingungen der Illegalität. Ich lag 1946, inzwischen Mitglied der KPD, in einem Leipziger Krankenhaus, also in der sowjetisch besetzten Zone, SBZ. Meine Mutter kam im gleichen Jahre, als senior officer einer halbmilitärischen Organisation, mit der britischen Besatzungsmacht nach Deutschland zurück. Freunde in der Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen in der SBZ schleusten sie mit gefälschten Dokumenten und ohne Wissen auch der britischen Dienststellen über die Zonengrenze ein, via Berlin.
1965 – sie hatte inzwischen einige Jahre in Schweden, danach erneut in London gelebt – besuchte sie mich, 77 Jahre alt, in Heidelberg. Fassungslos stand sie vor meinen Büchern: »Wie willst du das alles mitnehmen, wenn du mal weg mußt?« Ihr Besitz bestand noch immer aus zwei großen Koffern.
Nicht nur das Familien- und Schulverhältnis änderte sich in den ersten Jahren des NS-Staats, auch die »organisierten Außenbeziehungen«, mein Verhältnis zu den kollektiven Einrichtungen für kindliche Tätigkeit durchliefen einen Wandel.
1931, neun Jahre alt, war ich den Pfadfindern beigetreten, aber in den Probemonaten gewogen und als zu leicht befunden worden. Die Eltern erhielten einen Brief: Ich sei nicht ausdauernd, nicht leistungsbereit – eine Frage der Moral, nicht der körperlichen Konstitution; außerdem leider nicht offen und ehrlich . Kein richtiger deutscher Junge demnach (aber das stand nicht wörtlich in dem Brief). Gewiß: »Üb’ immer Treu’ und Redlichkeit«, das war nicht das Lied, das ich sang. Man muß kein Philosoph, man darf auch ein Kind sein, um zu bemerken, daß »Offenheit« in der pädagogischen Landschaft bedeutet, sich für den Zugriff der Macht zu öffnen. Wer sich verschließt, wer verstummt, gar lügt, sabotiert die allseitige Kontrolle des seelischen Materials, die nicht nur in der Ära des Nationalsozialismus das Geheimnis der mittelständischen Erziehung war.
Ein Jahr später sah ich bei einsamen Streifzügen in der Dresdner Heide mit Neid auf die »Falken« mit ihrem blauen Halstuch, eine Jugendorganisation der SPD, und mit einer Mischung aus Faszination und Angst auf singende und marschierende Gruppen der HJ, die sehr wenig Pfadfinderisches hatten. Doch im schönen Sommer 1933 lief ich begeistert zum Elbufer und schloß mich dem Jungvolk an, stolz auf Trommel, Fahne und Führertum. Im Herbst saß ich schon wieder zu Hause – gewogen und zu leicht befunden? Aus eigenem Entschluß? – und trieb mich allein in der Stadt herum.
Ich hatte einen Freund: Mit seinem Luftgewehr stiegen wir auf den Oberboden der Mietskaserne, in der er wohnte, und schossen aus einer winzigen Dachluke auf Tauben. Das flache Dach der Technischen Hochschule gegenüber beherbergte Brutkästen für wer weiß welches Experiment. Tauben, das waren feindliche Flugzeuge. Manchmal waren wir Rotarmisten und sangen: »Und höher, und höher, und höh-eer / ein jeder Propeller schreit surrend ›Rot Front‹! / Wir sind die Schützer der Sowjetunion.« In einem Holzkästchen bewahrte ich unseren Schatz auf: ein kleines silbernes Abzeichen der Hoheitsträger der NSDAP, den Reichsadler auf dem umkränzten Hakenkreuz (das Nädelchen zum Anstecken war abgebrochen), und einen glasierten Sowjetstern, rot, mit goldenem Hammer und Sichel. 2
Dieser Freund war der Sohn des Fleischers an der Ecke und besuchte die Oberrealschule, die ich hatte verlassen müssen. In der Volksschule fand ich für ein paar Monate Kontakt zu einem kleinen jüdischen Jungen der Volksschulklasse. Er nahm mich mit zu seinen Eltern, orthodoxe Juden, die in einem jüdischen Sträßchen in der Altstadt wohnten; der Vater – mit schwarzem Käppchen und rituellen Locken – war Tischler. Im Haus roch es, wie es eben bei armen Leuten riecht. Manches war mir unangenehm, ohne daß ich noch zu sagen wüßte, warum.
Читать дальше