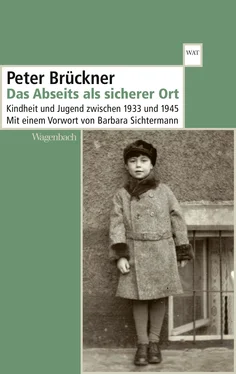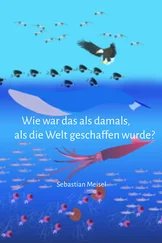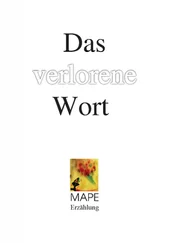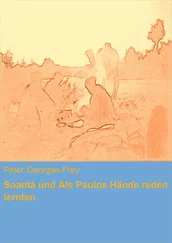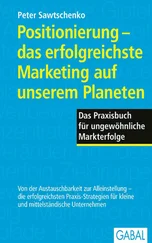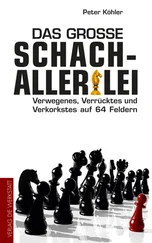Den Nichtorganisierten wurde samstags in der Volksschule Spezialunterricht erteilt, von HJ-Führern oder von Lehrern in SA-Uniform. Ob dies mir nun als das größere Übel erschien oder ob ich endlich als das anerkannt werden wollte, was ich doch war: als deutscher Junge jedenfalls trug ich im Frühjahr 1934 erneut das Braunhemd und hatte »Dienst«.
Die Infamie des Faschismus war in diesen Jahren noch nicht bürokratisiert, Individuen durften noch zerstörerisch sein auf eigene Faust. An einem Sonntagmorgen führte uns so ein siebzehnjähriger Condottiere, unser Scharführer, an Kirchen vorbei: Dort werde gegen Führer und Volk gepredigt. Besucht jemand den Gottesdienst? Dann soll er sich merken, was der Pfarrer sagt, und es ihm berichten; er werde es weiterleiten an die Gestapo. Er führte uns sogar ein anderes Mal zu einer Gestapo-Leitstelle, wo er jemanden kannte. Das alles war faszinierend, aber beängstigend, fesselnd, aber fremd; es stieß ab und erfüllte doch mit einem untergründigen Herzklopfen von Befriedigung. Allein daß am Sonntagmorgen »Dienst« angesetzt war, suggerierte Aufruhr: ein épater le bourgeois , gegen den langweiligen Feiertag, gegen die Kirche, gegen Ordnung gerichtet. (Das wurde übrigens bald verboten: die Ordnung kehrte zurück, das heißt, der Terror wurde arbeitsteilig organisiert, und antiautoritäre Gesten waren unerwünscht.)
Ich erzählte meinem Vater an einem unserer Wochenenden davon, und er verwickelte mich – für viele Monate – in kaum endende Gespräche: über Gott, Kirche, Freimaurerei (er war Atheist, zumindest neukantianisch: ignorabimus), über Wirtschaft und Staat. Die Wirtschaft als neue Monarchie , der »Untertan« müsse aber Bürger werden, der Arbeiter und Angestellte mitbestimmen; bei dieser Gelegenheit erfuhr ich etwas Verläßliches über Streiks. (Seine »konstitutionellen« Ideen verdankte er Friedrich Naumann – ein Name, den er oft genannt hat, wie auch den von Friedrich List.) Bei unseren Spaziergängen gab der »Damaschkeweg« Anlaß zu Bemerkungen über das Eigentum an Grund und Boden, über Arbeitersiedlungen und über Bodenreform. Wir sprachen auch über Denunziation und neuere Geschichte. Schließlich hielten die neuen Führer Zwölfjährige für reif genug, »politisch« zu sein, sollte er von seinem Zwölfjährigen schlechter denken? Er besorgte mir die Geschichte unserer Welt von H.G. Wells; ein kleines, verbotenes Buch über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, einen Roman von Upton Sinclair und ein gleichfalls verbotenes Buch mit Reportagen. Das begann mit rührenden Berichten von Charles Dickens und endete, glaube ich, mit Notizen von Egon Erwin Kisch (oder von Sling, dem Gerichtsreporter der Weimarer Zeit).
Im Laufe weniger Monate erloschen meine Beziehungen zum Jungvolk erneut – sie »erloschen« wirklich, erlahmten, schwanden dahin. Es war da von meiner Seite kein spektakulärer Akt im Spiel, etwa ein formeller Austritt. Ich fing einfach an, die »Kameraden«, die Organisation, die Führer zu meiden; suchte Plätze auf, wo ich sicher sein konnte: da waren sie nicht, verlegte meine wieder einsamen Streifzüge ins Abseits, wo ich für »mein« Fähnlein und es für mich unsichtbar war.
Bis wir uns schließlich aus den Augen verloren hatten. Diese zwar nicht erkämpfte, aber doch nicht ohne List selbsttätig herbeigeführte Einsamkeit enthielt eine Glückserfahrung, die mich allen Gefühlen von Vereinzelung enthob: Es gibt immer Orte zu finden, die leer von Macht sind. Die institutionelle Umklammerung des Lebens ist zu Anteilen Schein.
Bei meinen Wegen in das Antiquariatsviertel der Altstadt zog mich eines Tages der Lärm eines öffentlichen Ereignisses zum Rathausplatz; hohe SA-Führer (im Juni 1934 dann zum Teil erschossen) eilten in schwarzen Stiefeln und Breeches eine Treppe hinauf, die sich ins Unendliche zu erstrecken schien. Ich zwängte mich durch die Massen, die frenetisch Beifall spendeten, bis zur Absperrung: nichts als Auge, als sinnliche Wahrnehmung, unberührt von den Emotionen um mich herum, erneut das »Abseits« als Bedingung der Erfahrung von Glück. Später besuchte Hitler die Stadt. Am Tage danach saß ich im Omnibus mit Vater und Onkel, die sich in englischer Sprache unterhielten; uns gegenüber zwei SS-Leute der Leibstandarte Adolf Hitlers. Sie hielten uns für Briten, einer beugte sich vor: »Have you seen us? We are Hitlers bodyguard.« Ich hielt zu dieser Zeit gerade sehr wenig von meiner Verwandtschaft, aber die Situation entflammte mich minutenlang für meinen Onkel, der kühl und unnahbar blieb, und ebensowenig wie mein Vater den Irrtum aufzuklären beabsichtigte. Macht ist dumm.
Einige Zeit später wohnte ich für ein paar Wochen bei einem Vetter meines Vaters. Ich mochte diesen Vetter nicht. Das hatte mit meiner Mutter zu tun, die in der Familie des Vetters nicht als deutsche Mutter galt: egoistisch, nicht verantwortungsbewußt, eine Katastrophe für den Ehemann. Und meine Abneigung – eigentlich eine Mischung aus Angst und Haß, gemildert durch Neugier – antwortete auch auf den Umstand, daß der Vetter und seine Frau, wiewohl antifaschistisch, ihre Kinder quasi-faschistisch erzogen; ohne das zu ahnen, besten Gewissens. Sie sahen in der autoritären Psychose, die man in Deutschland »Erziehung« nennt, ein Antidot gegen den NS-Staat. Auch in der Pedanterie ihres täglichen Kleinterrors und ihrer Verdachtspsychologie. Auch sie hatten am normalen Faschismus teil: sie rochen die Abweichung (in der ihnen »fremden« Schwägerin, im aufrührerischen Kind). Ein deutscher Antinazi konnte allemal ein zur Sparsamkeit gezwungener Mittelständler sein, das war schlimm genug.
Der Nationalsozialismus, die zum Staat gewordene Unordnung, hatte, was »gut« an ihm war, der Familie des Vetters sozusagen gestohlen – Turnen, den Mythos der frischen Luft, die tägliche Hygiene und Sauberkeit. Aber Hitler schwächte die Religion des Gehorsams. Den schuldeten Kinder den Erwachsenen. Es wurde über Anweisungen der Erwachsenen nicht diskutiert, das gab es in der HJ. Tischsitten waren heilig, jedenfalls was meine Wirtsfamilie unter Tischsitten verstand: etwas sehr Penibles, verknüpft mit der Idee des einfachen Lebens, vor allem mit Schwarzbrot. Und Kindheit, das war ein Paradies, so gut geht’s einem nie wieder. Als ich meine Mutter an einem Samstag besuchte (der mit ihr verabredete Besuchstag), sie hatte gerade ein Engagement in der Stadt, im sogenannten Schweizer Viertel, fand ich sie von Kopfschmerzen geplagt und ohne einen Pfennig Geld. Ich kehrte um, verlangte von meinen Wirten mein Taschengeld, das es immer sonntags gab, um es meiner Mutter zu bringen – für eine Schachtel Aspirin hätte es vielleicht gelangt – und erhielt es nicht: Sonntags wurde es ausgeteilt. No discussions , jedenfalls sprach der Vetter meines Vaters ein paar Worte Englisch, als Dokumentation nicht von Bildung, sondern von Antifaschismus. (Diese Sitte ist mir später wieder begegnet, aber unter anderen Menschen und unter erfreulichen Umständen. 3)
Einige Tage danach lief ich meinen Wirten weg, ging zurück in die elterliche Wohnung, in der niemand mehr war (bis auf den Untermieter 4) und blieb dort. Aber wie sollte ich mein Gepäck aus der Wohnung der Verwandten kriegen – darunter die Schuhe? Ich war im »Abseits« durchaus ruchlos geworden, wenn ich mir nicht anders zu helfen wußte. Ein Stück Darwinismus benötigt, wer in den Sozialdarwinismus der mittelständischen Familie verstrickt ist. Der Vetter wohnte weit weg von uns in einem Stadtviertel, in dem mich keiner kannte. So ging ich – noch immer in Hausschuhen zur HJ-Dienststelle dieses Viertels, behauptete, ich sei Mitglied, erzählte eine Schauergeschichte und erreichte es, daß zwei Ältere in Uniform zu meinen Verwandten gingen und dort auf sofortiger Herausgabe meines Koffers bestanden. Ich verschwand mit meinen Sachen und ließ mich in diesem Viertel nie wieder sehen.
Читать дальше