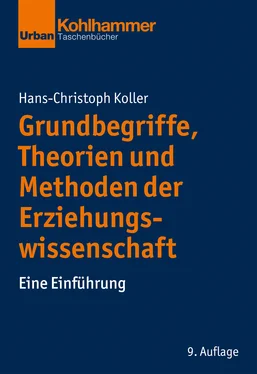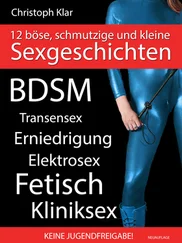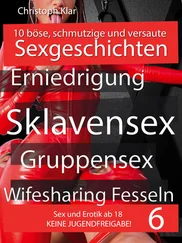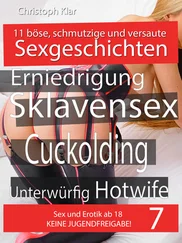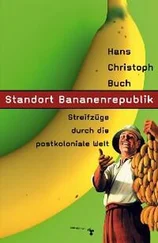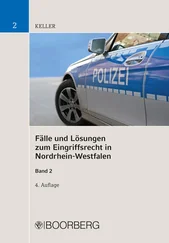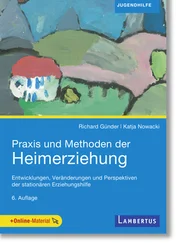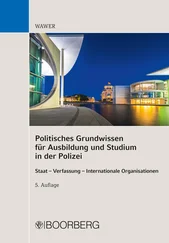Auch wenn man Kant darin zustimmt, dass der oben erwähnte kategorische Imperativ ausreiche, um zu begründen, warum ein bestimmtes Verhalten lasterhaft, d. h. unmoralisch und deshalb verabscheuenswert ist, bleibt die Frage, wie man Kinder dies »lehren« kann. Kants Antwort auf diese Frage findet sich an einer späteren Stelle der Vorlesung, an der er die Prinzipien, an denen das Handeln sich ausrichten soll, als »Maximen« bezeichnet und von bloßer »Disziplin« oder »Angewohnheit« abgrenzt. Maximen, so heißt es da, sind Prinzipien des Handelns, deren »Billigkeit« das Kind selbst einsehe (Kant 1803/1983, S. 740). Das Kind soll also die Angemessenheit der moralischen Prinzipien, an denen sein Handeln sich orientiert, selber erkennen. Die Instanz, auf die alles ankommt, ist mithin die Einsicht des Kindes, sein Urteil, das auf den selbstständigen Gebrauch des eigenen Verstandes zurückgeht.
Die entscheidende Frage innerhalb der Erziehungstheorie Kants lautet deshalb: Wie können Kinder zur Einsicht, d. h. zum selbstständigen Gebrauch ihres Verstandes gebracht werden? Kants Antwort ist eine doppelte: Es brauche dazu sowohl Zwang als auch Freiheit, und das entscheidende Problem bestehe darin, beides auf die richtige Weise miteinander zu verbinden. Kants berühmte Formel für dieses Problem, in der sich sein wichtigster und bedenkenswertester Beitrag zur Theorie der Erziehung verbirgt, lautet: »Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?« (Kant 1803/1983, S. 711).
Es lohnt sich, etwas länger bei dieser Formel zu verbleiben und dabei drei Fragen zu klären – nämlich erstens, was Kant unter »Freiheit« versteht, zweitens, weshalb diese Freiheit der Kultivierung (und d. h. der Bearbeitung und Verfeinerung) bedarf, und drittens, weshalb für Kant neben der Kultivierung von Freiheit auch die Ausübung von Zwang als ein unverzichtbarer Bestandteil von Erziehung gilt. Beginnen wir mit der ersten Frage. Freiheit ist für Kant zunächst die »Unabhängigkeit von Gesetzen«, nach welcher der Mensch ein natürliches Bedürfnis habe (Kant 1803/1983, S. 698). In diesem Sinne meint Freiheit das, was man Willkürfreiheit nennen kann: die Möglichkeit, dem eigenen Willen bzw. der eigenen »Laune« zu folgen (ebd.). Bei Kindern zeigt sich der Hang zu solcher Freiheit Kant zufolge in ihrer Tendenz, »jeden ihrer Einfälle würklich auch und augenblicklich in Ausführung [zu] bringen« (ebd.). Freiheit bedeutet im Kontext der Pädagogik-Vorlesung, wie im Folgenden noch deutlich werden wird, aber auch eine Art praktischer Selbstständigkeit, nämlich den Zustand, »nicht von der Vorsorge anderer ab[zu]hängen« (ebd., S. 711). Und schließlich gilt Freiheit Kant auch (wie bereits oben zitiert wurde) als die entscheidende Voraussetzung für Aufklärung, nämlich als Möglichkeit, »von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen« (Kant 1784/1983, S. 55) – und d. h. als Bedingung von Mündigkeit. Man kann daher annehmen, dass für Kant alle drei Arten von Freiheit – Willkürfreiheit, Selbstständigkeit und Mündigkeit – im Erziehungsprozess eine Rolle spielen und Gegenstand der Kultivierung werden sollen.
Was aber bedeutet dieses Kultivieren der Freiheit? Bei Kant heißt es direkt im Anschluss an die zitierte Formel: »Ich soll meinen Zögling gewöhnen, einen Zwang seiner Freiheit zu dulden, und soll ihn selbst zugleich anführen, seine Freiheit gut zu gebrauchen« (Kant 1803/1983, S. 711). »Kultivieren« ist also doppelt zu verstehen: Zum einen bezeichnet es negativ die Einschränkung von Freiheit (»einen Zwang seiner Freiheit zu dulden«), zum andern positiv eine Anleitung zum ›guten‹ Gebrauch der Freiheit. Die erste Bedeutung bezieht sich dabei wohl vor allem auf die Willkürfreiheit, die zweite auch auf Freiheit im Sinne von Selbstständigkeit und Mündigkeit.
Sofern das Kultivieren der Freiheit als Einschränkung zu begreifen ist, fällt die Frage nach dem Sinn dieser Kultivierung mit der Frage nach der Notwendigkeit von Zwang zusammen. Kants Vorlesung lassen sich drei verschiedene Gründe dafür entnehmen, warum Zwang nötig ist. Diesen drei Gründen entspricht jeweils eine Regel für das Handeln von Erziehern, die als Begrenzung erzieherischer Zwangsausübung verstanden werden kann. Die erste Begründung für die Notwendigkeit des Zwangs findet sich dort, wo von der so genannten ›positiven‹ Unterwürfigkeit des Kindes die Rede ist, die darin bestehe, dass der Zögling »tun muß, was ihm vorgeschrieben wird, weil er nicht selbst urteilen kann, und die bloße Fähigkeit der Nachahmung noch in ihm fortdauert« (Kant 1803/1983, S. 711). Zwang bzw. Unterwerfung ist für Kant also in dem Maße unvermeidlich, in dem das Kind nur über die Fähigkeit zur Nachahmung verfügt und noch nicht in der Lage ist, selbstständige Urteile zu treffen. Dem entspricht die (den Zwang limitierende) Regel, dass die Einschränkung der Freiheit dann (und nur dann) geboten ist, wenn das Kind sich andernfalls selbst Schaden zufügen würde. So fordert Kant, »daß man das Kind, von der ersten Kindheit an, in allen Stücken frei sein lasse (ausgenommen in den Dingen, wo es sich selbst schadet)« (ebd.).
Der zweite Grund entspricht dem, was Kant ›negative‹ Unterwürfigkeit nennt, die darauf beruhe, dass der Zögling »tun muß, was andere wollen, wenn er will, daß andere ihm wieder etwas zu Gefallen tun sollen« (Kant 1803/1983, S. 711). Hier liegt die Begründung für die Notwendigkeit des Zwangs in der Dialektik sozialer Beziehungen: Das Kind muss lernen, sich dem Willen eines anderen unterzuordnen, weil bzw. sofern es etwas von diesem anderen will. Daraus folgt als zweite Regel für pädagogisches Handeln, dass man einem Kind zeigen solle, »daß es seine Zwecke nicht anders erreichen könne, als nur dadurch, daß es andere ihre Zwecke auch erreichen lasse« (ebd.). Die Einschränkung der (Willkür-)Freiheit, so könnte man sagen, ist notwendig, sofern diese auf die Freiheit der anderen stößt und dort ihre Grenze findet.
Als dritte Begründung für den Zwang als unverzichtbares Erziehungsmittel führt Kant an, dass das Kind »den unvermeidlichen Widerstand der Gesellschaft fühlen« müsse, da es nur so die Schwierigkeit kennen lernen könne, »sich selbst zu erhalten, zu entbehren, und zu erwerben, um unabhängig zu sein« (Kant 1803/1983, S. 711). Zwang ist in diesem Sinne nötig im Interesse künftiger Selbstständigkeit, sofern diese nämlich Fähigkeiten voraussetzt, die nicht von selbst entstehen: die Fähigkeit, sich durch Arbeit bzw. Erwerbstätigkeit »selbst zu erhalten« und zu diesem Zweck auch Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Daraus ergibt sich als dritte pädagogische Regel, dass die Einschränkung der Freiheit nur in dem Maße gerechtfertigt ist, wie sie sich im Interesse künftiger Freiheit (im Sinne von Selbstständigkeit) als erforderlich erweist: Man müsse, so Kant, dem Kind »beweisen, daß man ihm einen Zwang auferlegt, der es zum Gebrauche seiner eigenen Freiheit führt, daß man es kultiviere, damit es einst frei sein könne« (ebd.).
Gewiss lassen diese Ausführungen Kants noch etlichen Spielraum für Interpretationen. So wäre z. B. in Bezug auf die letzte Bestimmung an konkreten Beispielen zu diskutieren (was gleich versucht werden soll), inwiefern die Ausübung von Zwang im Interesse künftiger Freiheit notwendig und gerechtfertigt ist. Dennoch bleibt festzuhalten, dass Kants Begründungen für die Notwendigkeit von Zwang und seine Regeln für pädagogisches Handeln primär als Begrenzungen erzieherischer Zwangsausübung zu verstehen sind. Anders formuliert: Abgesehen von den genannten Gründen und jenseits der gezogenen Grenzen ist den Zöglingen Kant zufolge völlige Freiheit einzuräumen. Die positive Dimension des ›Kultivierens‹, d. h. die Anleitung zum richtigen Gebrauch der Freiheit, hat also zur Voraussetzung, dass Kindern Freiheit gewährt wird.
Читать дальше