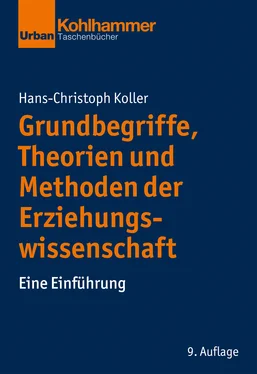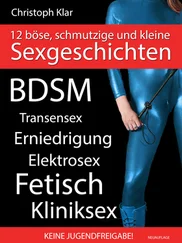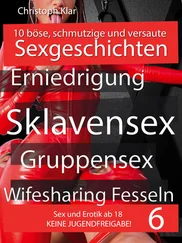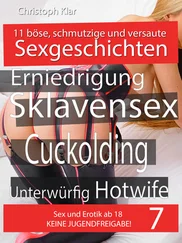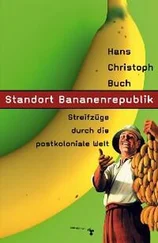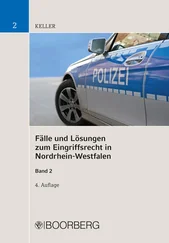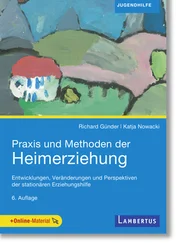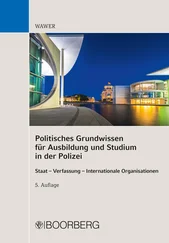Entscheidend für Kant jedoch ist, dass die Entwicklung der menschlichen Anlagen in keinem Fall von ganz alleine geschieht, sofern die Natur dem Menschen auch dazu keinen Instinkt verliehen hat. Deshalb ist Erziehung als diejenige Tätigkeit, die diese Entwicklung befördern soll, Kant zufolge eine »Kunst«, d. h. im Sprachgebrauch der Zeit etwas, was ein spezifisches Können erforderlich macht. Und diese Kunst soll nicht einfach »mechanisch« ausgeübt werden, d. h. planlos und nur den jeweiligen Umständen angepasst, sondern »judiziös« (Kant 1803/1983, S. 702), also planvoll und auf begründeten Urteilen beruhend (vom lateinischen judicare = urteilen). In dieser Formulierung klingt die Forderung nach einer wissenschaftlich begründeten Pädagogik an, die das Geschäft der Erziehung nicht dem gleichsam mechanischen Alltagshandeln überlässt, sondern zum Gegenstand gründlicher Reflexion und abwägenden Urteilens macht.
Einen wichtigen Grundsatz dieser Pädagogik bildet Kant zufolge nun die Zukunftsorientierung pädagogischen Handelns, von der bereits in der Einleitung dieses Buchs die Rede war:
»Ein Prinzip der Erziehungskunst, das besonders solche Männer, die Pläne zur Erziehung machen, vor Augen haben sollten, ist: Kinder sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern dem zukünftig möglich bessern Zustande des menschlichen Geschlechts, das ist: der Idee der Menschheit, und deren ganzer Bestimmung angemessen, erzogen werden. Dieses Prinzip ist von großer Wichtigkeit. Eltern erziehen gemeiniglich ihre Kinder nur so, daß sie in die gegenwärtige Welt, sei sie auch verderbt, passen. Sie sollten sie aber besser erziehen, damit ein zukünftiger besserer Zustand dadurch hervorgebracht werde.« (Kant 1803/1983, S. 704)
Die »Idee der Menschheit« als eines erst noch zu verwirklichenden Entwicklungspotenzials hat für Kant also zur Folge, dass Erziehung nicht nur und nicht einmal in erster Linie darin besteht, Kinder auf das Leben in der Welt vorzubereiten, wie es gegenwärtig ist. Erziehung im Sinne einer Unterstützung beim Finden der eigenen Bestimmung lässt sich vielmehr daran messen, inwiefern sie dazu beiträgt, eine Welt zu schaffen, wie sie sein könnte oder sollte – z. B. indem erzieherisches Handeln Heranwachsenden dazu verhilft, ihre gesellschaftlichen Lebensbedingungen nicht einfach als gegeben hinzunehmen, sondern selbst aktiv zu gestalten und zu verändern.
Im weiteren Verlauf seiner Argumentation beschreibt Kant nun vier aufeinander aufbauende Stufen des Erziehungsprozesses, die er Disziplinierung, Kultivierung, Zivilisierung und Moralisierung nennt. 4Disziplinierung als die erste dieser Stufen bedeutet für Kant »suchen zu verhüten, daß die Tierheit nicht der Menschheit, in dem einzelnen sowohl, als gesellschaftlichen Menschen, zum Schaden gereiche« (Kant 1803/1983, S. 706). Die Vorbedingung einer Erziehung, die auf die »Vervollkommnung der Menschheit« abzielt, besteht also darin, dafür Sorge zu tragen, dass die tierische Natur des Menschen der »proportionierlichen« Entfaltung seiner spezifisch menschlichen Anlagen nicht im Wege steht. Wir können dieser Formulierung entnehmen, dass Kant nicht alle natürlichen Eigenschaften des Menschen gleichermaßen für wert befindet, entwickelt zu werden, weil einige, die dessen »Tierheit« ausmachen, die Entfaltung der anderen behindern könnten. Auch spätere für die Geschichte der Pädagogik bedeutsame Denker wie z. B. Sigmund Freud sind diesem Gedankengang gefolgt und sehen in der Beherrschung der eigenen (vor allem sexuellen und aggressiven) Triebe eine zentrale (wenn auch keineswegs unproblematische) Aufgabe der Erziehung (vgl. z. B. Freud 1933/1994, S. 575–579).
Die zweite Stufe des Erziehungsprozesses nennt Kant Kultivierung und versteht darunter die »Verschaffung der Geschicklichkeit«, d. h. desjenigen »Vermögens, welches zu allen beliebigen Zwecken zureichend ist« (Kant 1803/1983, S. 706). Auf dieser Stufe geht es also darum, dem Kind alle die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verschaffen, die notwendig sind, um irgendwelche »Zwecke« zu erreichen – ganz unabhängig davon, um welche Zwecke es sich dabei handelt. Kant spricht in diesem Zusammenhang auch von »Belehrung und Unterweisung« und nennt als Beispiele Lesen und Schreiben. Daraus erhellt, dass die »Geschicklichkeit«, um die es ihm zu tun ist, auch eine gesellschaftlich-historische Dimension hat, denn diese Fähigkeiten sind erst seit Durchsetzung der Schriftkultur einigermaßen unentbehrlich (während man heute wohl auch die Vermittlung der Fähigkeit, einen Computer zu bedienen, zur Kultivierung im Sinne Kants rechnen müsste).
Als dritte Stufe führt Kant die Zivilisierung an, die für ihn darin besteht, dafür zu sorgen, »daß der Mensch auch klug werde, in die menschliche Gesellschaft passe, daß er beliebt sei, und Einfluß habe« (Kant 1803/1983, S. 706). Während es bei der Kultivierung eher um sachbezogene Fähigkeiten geht, stehen bei der Zivilisierung soziale Kompetenzen und Haltungen im Vordergrund, die für das gesellschaftliche Zusammenleben erforderlich sind. Kant bezeichnet diese Kompetenzen daher auch als »Manieren, Artigkeit und eine gewisse Klugheit«, die man brauche, um im Umgang mit anderen Menschen eigene Zwecke zu verfolgen (ebd., S. 707). In diesem Zusammenhang verweist Kant selbst auf die historische Veränderlichkeit solcher Zivilisierung – sie richte sich »nach dem wandelbaren Geschmacke jedes Zeitalters«.
Insofern erscheint die Zivilisierung ähnlich wie die Kultivierung als moralisch neutral oder unter Umständen sogar fragwürdig. Deshalb bedarf es im Argumentationsgang von Kants Erziehungstheorie noch einer vierten Stufe, der Moralisierung:
»Der Mensch soll nicht bloß zu allerlei Zwecken geschickt sein, sondern auch die Gesinnung bekommen, daß er nur lauter gute Zwecke erwähle. Gute Zwecke sind diejenigen, die notwendigerweise von jedermann gebilligt werden; und die auch zu gleicher Zeit jedermanns Zwecke sein können.« (Kant 1803/1983, S. 707)
Es ist diese Stufe, die den entscheidenden Beitrag Kants zu einer modernen Theorie der Erziehung darstellt. Während Kant zufolge Disziplinierung, Kultivierung und Zivilisierung in der pädagogischen Praxis seiner Zeit bereits in ausreichendem Maß realisiert wurden, bleibt die Moralisierung seiner Ansicht nach ein noch unerreichtes Ziel. Anders als bisher geht es auf dieser Stufe nicht mehr um äußere Verhaltensweisen, Fähigkeiten und »Manieren«, sondern um das Innere des Menschen, seine »Gesinnung«. Und im Unterschied zu den beiden vorhergehenden Stufen sind dabei die Zwecke nicht beliebig, sondern werden einem moralischen Kriterium unterworfen: Sie sollen »gut« sein, d. h. von jedermann »gebilligt« und von jedermann gleichzeitig verfolgt werden können. Im Kern entspricht dieses Kriterium dem »kategorischen Imperativ«, den Kant an anderer Stelle folgendermaßen formuliert hat: »Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne« (Kant 1788/1983, S. 140).
Dieses Ziel ist, wie Kant ausdrücklich betont, im Unterschied zur Disziplinierung (und in gewisser Weise auch zur Kultivierung und Zivilisierung) nicht durch bloße Dressur zu erreichen. Denn zu seiner Erreichung sei es notwendig, »daß Kinder denken lernen« und ihr Handeln statt an Verboten und Strafen oder bloßen Opportunitätsgesichtspunkten an begründungsfähigen »Prinzipien« ausrichten (Kant 1803/1983, S. 707). Das Beispiel, an dem Kant diesen Gedankengang zu verdeutlichen sucht, ist das »Laster«. Unendlich wichtig sei es, »die Kinder von Jugend auf das Laster verabscheuen zu lehren, nicht gerade allein aus dem Grunde, weil Gott es verboten hat, sondern weil es in sich selbst verabscheuungswürdig ist« (ebd.). Nicht das göttliche (oder elterliche) Verbot dient hier als Bezugspunkt und Instanz der Moralisierung, sondern die Einsicht in die Sache selbst, aus der für Kant die Verabscheuungswürdigkeit des Lasters unmittelbar hervorgeht.
Читать дальше