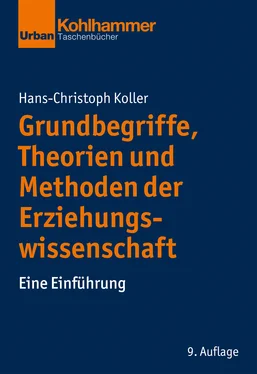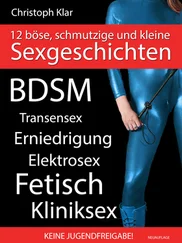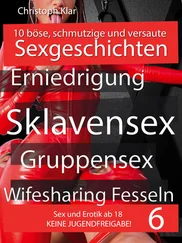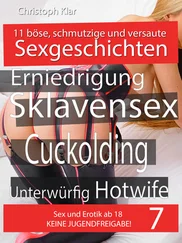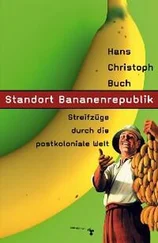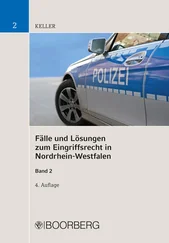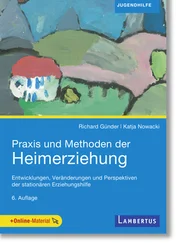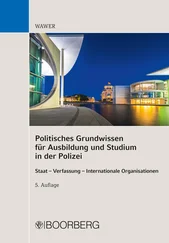Die Darstellung von Grundbegriffen und Theorien der Erziehungswissenschaft beginnt mit dem Begriff der Erziehung. Das ist naheliegend (schließlich heißt die Disziplin ja auch Erziehungswissenschaft), versteht sich aber keineswegs von selbst. Denn da die beiden anderen Begriffe, die im Folgenden erörtert werden sollen, nämlich Bildung und Sozialisation, in ihrem Gegenstandsbereich jeweils umfassender sind als der Erziehungsbegriff, gäbe es gute Gründe, die Darstellung mit einem von ihnen zu beginnen. Für einen Anfang mit dem Grundbegriff Erziehung sprechen jedoch vor allem zwei Argumente. Zum einen ist Erziehung im Unterschied zu Sozialisation und Bildung ein Wort, das auch in der Alltagssprache in relativ klar umrissener Bedeutung vorkommt und deshalb für einen Einstieg besser geeignet ist als der Fachterminus Sozialisation oder der vieldeutige Bildungsbegriff. Und zum andern entspricht von den drei genannten Grundbegriffen der Erziehungsbegriff am ehesten der Perspektive, die pädagogisch Handelnde auf die Erziehungswirklichkeit haben, und eignet sich deshalb besser dazu, einen ersten Zugang zur wissenschaftlichen Analyse pädagogischer Handlungssituationen zu eröffnen.
Dabei nimmt die Erörterung des Erziehungsbegriffs ihren Ausgang von einer Fassung, die dieser Begriff in der Zeit um 1800 gefunden hat. Der Zeitraum von etwa 1770 bis 1830 kann in historischer Perspektive als eine Phase entscheidender Veränderungen in der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Verfasstheit der mittel- und westeuropäischen Gesellschaften angesehen werden – Veränderungen, die in vielerlei Hinsicht bis heute fortwirken. Sozialgeschichtlich betrachtet handelt es sich bei dieser Zeit um die Phase, in der die feudale Ständegesellschaft von einer bürgerlichen Gesellschaftsordnung abgelöst wird, und ideengeschichtlich gesehen entstehen im selben Zeitraum spezifisch moderne Auffassungen vom Menschen und seinem Verhältnis zur Gesellschaft und zur Welt. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem kulturellen Phänomen der Aufklärung zu, einer europäischen Bewegung, die im 17. Jahrhundert begann und in Deutschland ihren Höhepunkt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte.
1.1 »Was ist Aufklärung?«
Eine prägnante Beschreibung der Grundgedanken dieser Bewegung findet sich in der berühmten Schrift »Was ist Aufklärung?« von Immanuel Kant (1724–1804), der als einer der wichtigsten Vertreter aufklärerischen Denkens gilt. Dort heißt es:
»Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.« (Kant 1784/1983, S. 53)
Entscheidender Bezugspunkt für die Begründung individuellen wie kollektiven Handelns ist Kant zufolge also weder die Berufung auf Tradition und Sitte noch die Autorität politischer oder religiöser Obrigkeiten, sondern der menschliche Verstand, von dem jeder Einzelne selbstständig Gebrauch machen kann und soll. Den Gegensatz zu diesem selbstständigen Gebrauch markiert die »Leitung« durch andere, für die Kant im weiteren Verlauf seiner Schrift anschauliche Beispiele anführt. Da gibt es das Buch, dessen Lektüre an die Stelle der Benutzung des eigenen Verstandes tritt, den Seelsorger, der eigene Gewissensentscheidungen überflüssig macht, den Arzt, der Diätvorschriften erlässt, sowie ganz allgemein »Satzungen und Formeln«, die Kant als »Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit« bezeichnet, weil sie den selbstständigen Gebrauch des Verstandes ver- oder behindern (Kant 1784/1983, S. 54).
Dafür, dass die Menschen solchen Vorschriften folgen, statt sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, führt Kant vor allem zwei Gründe an: einerseits die »Faulheit und Feigheit« (Kant 1784/1983, S. 54) derer, die sich von anderen leiten lassen, und andererseits Drohungen und Bevormundungen von Seiten der Obrigkeiten, die Leitung ausüben, indem sie die Freiheit ihrer Untertanen einschränken und Mündigkeit als etwas Gefährliches darstellen. Die entscheidende Bedingung von Aufklärung besteht für Kant daher in nichts anderem als in der Freiheit, »von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen« (Kant 1784/1983, S. 55). Hier kommt eine wichtige politische Dimension aufklärerischen Denkens zum Ausdruck, die in der Forderung nach Freiheitsrechten für alle Bürger besteht – und d. h. hier in erster Linie in der Forderung nach dem Recht jedes Menschen, seine eigene Meinung in Wort und Schrift öffentlich kundzutun. 1
Die Grundgedanken der Aufklärung haben auch für den Bereich der Erziehung Konsequenzen. Das lässt sich besonders gut am Beispiel von Kants Vorlesung »Über Pädagogik« verdeutlichen, die 1776/77 erstmals gehalten, aber erst 1803 veröffentlicht wurde. Zuvor freilich gilt es, den erziehungshistorischen Kontext von Kants pädagogischen Überlegungen zu skizzieren.
1.2 Das »pädagogische Jahrhundert«
Das 18. Jahrhundert ist bereits von Zeitgenossen als das »pädagogische Jahrhundert« bezeichnet worden (vgl. Tenorth 2010, S. 79). Aus heutiger Sicht ist dies insofern einleuchtend, als sich in diesem Jahrhundert nicht nur neue (und in ihren Grundzügen bis heute wirksame) Auffassungen von Erziehung durchgesetzt haben, sondern auch wesentliche Momente der praktischen Organisation von Erziehung, ohne die unser heutiges Erziehungssystem nicht denkbar wäre.
Eine entscheidende Voraussetzung moderner Erziehungsvorstellungen ist das, was man die »Entdeckung der Kindheit« genannt hat. Wie der französische Historiker Philippe Ariès in seiner bahnbrechenden »Geschichte der Kindheit« gezeigt hat, gab es Kindheit als eine besondere, vom Erwachsenenalter abgegrenzte Lebensphase keineswegs schon immer. Die Auffassung, dass Kinder eine von den Erwachsenen deutlich geschiedene Altersgruppe bilden, ist Ariès zufolge vielmehr eine Errungenschaft der Neuzeit, die in Europa seit etwa 1500 allmählich aufkam und sich erst im 19. Jahrhundert in allen Bevölkerungsschichten endgültig durchgesetzt hat. Ein besonders eindrücklicher Beleg, den Ariès für diese These anführt, ist die Darstellung des kindlichen Körpers in der Bildenden Kunst. Während Kinder auf Bildern aus dem Mittelalter noch durchweg als verkleinerte Erwachsene dargestellt werden, entsteht erst ab etwa 1500 allmählich ein Blick für die Besonderheit kindlicher Körperproportionen (vgl. Ariès 1975/2007, S. 92ff.).
Im Zuge dieser Entdeckung der Kindheit als einer eigenen Lebensphase setzen sich Ariès zufolge nun auch besondere, pädagogische Formen des Umgangs mit Kindern durch. Während Kinder bisher vor allem durch die selbstverständliche Teilnahme am Leben der Erwachsenen in deren Welt hineinwuchsen, werden sie nun, wie Ariès an einer Fülle von Beispielen demonstriert, immer mehr aus dieser Welt ausgegrenzt, in eine Art Schonraum versetzt und einer Sonderbehandlung unterzogen, die man als »Erziehung« im modernen Sinne bezeichnen kann. Ein deutliches Indiz dieser Entwicklung ist etwa die auch von anderen Historikern beschriebene Entstehung der modernen (Klein-)Familie, die sich durch eine private, von der Außenwelt bzw. vom Arbeitsleben abgeschirmte und emotional aufgeladene Binnensphäre auszeichnet, in deren Mittelpunkt das Kind bzw. die Kinder stehen.
Parallel dazu etabliert sich in einem langen Prozess seit dem Mittelalter auch eine besondere Institution zur Vorbereitung der Kinder auf das Leben in der Gesellschaft: die Schule. Die paradoxe Struktur dieser Institution, die auf das Alltagsleben vorbereitet, indem sie die Kinder daraus ausgrenzt, beruht u. a. darauf, dass das Erwachsenenleben zu komplex, zu störungsanfällig oder zu gefährlich geworden ist, um Kinder das, was zur aktiven Teilnahme daran notwendig ist, wie früher einfach durch Partizipation und Nachahmung lernen zu lassen. Aus diesem Grund entsteht im Laufe der Zeit eine besondere, aus dem Alltagsleben ausgegliederte Institution, in der Kindern die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten systematisch vermittelt werden. Wie lange der Prozess der Durchsetzung dieser Institution gedauert hat, kann man daran ablesen, dass die allgemeine Schulpflicht in Preußen zwar schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts verkündet wurde, aber erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf breiter Ebene (d. h. vor allem auch für die Kinder der Unterschichten, die zuvor als Arbeitskräfte benötigt wurden) wirklich durchgesetzt werden konnte (vgl. Herrlitz, Hopf, Titze & Cloer 2005, S. 50f.).
Читать дальше