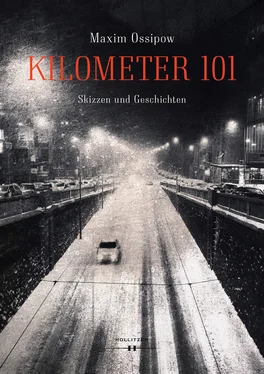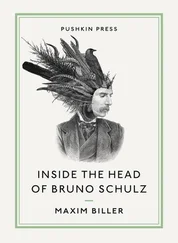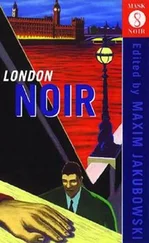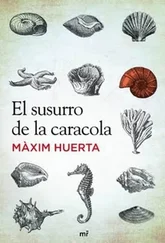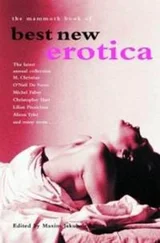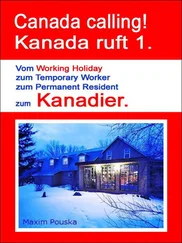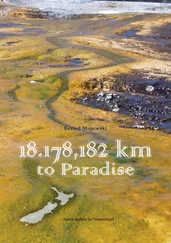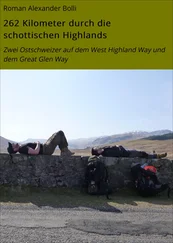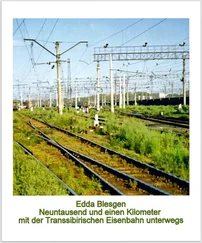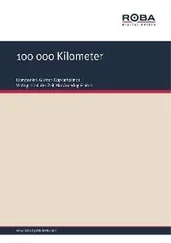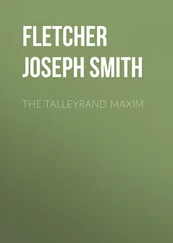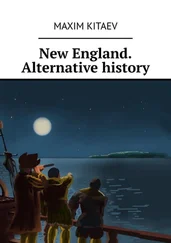Sie beriet sich mit den Weibern und nannte die Namen von fünf Mitgliedern der Kommunistischen Partei, so viele hatten wir nämlich. Sie wurden in die Nachbarstadt gebracht und erschossen. Sie sollte weitere fünf Namen angeben. Die Weiber nannten Säufer, Faulenzer, Nichtsnutze. Die wurden ebenfalls erschossen. Als der Befehl kam, noch fünf Namen zu nennen, sagte die Vorsitzende, dass es keine Trotzkisten mehr gebe. Daraufhin wurde sie gewarnt, wenn sie nicht fünf benenne, würden sie fünfzehn holen. Sie schrieb die Namen aller Männer der Kolchose auf Zettel (zweihundert Mann) und zog nach dem Losverfahren fünf heraus. Man brachte die Männer weg, und damit war der Kampf gegen den Trotzkismus zu Ende. (So sehen die Opfer unseres Terrors aus: ein Drittel Kommunisten, ein Drittel Nichtsnutze, darunter Ossip Mandelstam, ein Drittel zufällige Personen.)
Mit seinem selbstgemachten Besen aus Birkenzweigen fegt unser Hausmeister am Eingang. Dort stehen meine Freunde und ich – sie sind aus Moskau mit mehreren Autos gekommen. Der Hausmeister strengt sich an, so zu fegen, dass der Staub in unsere Richtung fliegt, wir gehen zur Seite, er hinterher, missbilligend Obszönes brummelnd, fegt er weiter. Als Erstes drehen die Nerven des Hausmeisters durch, er ist betrunken. „Sag mir, du bist hier der Chef“, (ich habe nämlich den weißen Kittel an), „hast du nach dem Krieg die Quadrattaschen essen müssen?“ Das ist alles, was er vorbringen möchte – seine durchaus echten durchgemachten Leiden und den ebenso echten Alkoholismus.
Der verständlichste und wohl angenehmste Typ Patienten, das sind die aus der Intelligenz. Natürlich beansprucht die Unterhaltung mit einem Intellektuellen zwei-, dreimal so viel Zeit wie mit den anderen, natürlich antwortet er auf die Frage „Was arbeiten Sie?“, dass er Mitglied in sechs Künstlerverbänden ist, und wenn man ihn fragt, wann die Atemnot begann, hörst du, dass er am Beginn der Achtzigerjahre auf Einladung des Komponistenverbands Armeniens in das Künstlerhaus in Dilidschan fuhr. Gut, ich war ebenfalls in Dilidschan und erinnere mich noch an seinen Film mit Schuberts „Unvollendeter“, erinnere mich daran, was Mrawinskij über die Interpretation des zweiten Satzes sagt. Nach so einem Gespräch kannst du sicher sein, dass dein Intellektueller die Verordnungen befolgt. Ob er raucht, brauchst du nicht zu fragen – ja, Papirossy „Belomor“.
Was verbindet diese Vielzahl von Russländern, was rettet das Land vor dem Zerfall? In den schlechtesten Augenblicken meinst du: nur die Trägheit. „Ich kam auf den Gedanken, dass das Sowjetsystem paradoxerweise viele Mängel des vorrevolutionären Russlands konserviert hat“, schreibt mir mein Freund aus Boston. Wir wenden uns zurück ins neunzehnte Jahrhundert, sogar orthografisch: gebt uns das harte Zeichen (Ъ) zurück, dann wird uns keiner mehr ein X für ein U vormachen. Unser Platz in der Völkerfamilie ist der eines Schülers, der sitzen bleiben wird. Er hockt noch mit seinen Kameraden in der alten Klasse bis zum Sommer, aber Anforderungen kann man an ihn keine mehr stellen. Diskussionswürdig oder, falls notwendig, abzulehnen, sind die anderen, nicht wir. Sitzt da so ein Lümmel, der Längste der Klasse, in der Bank, was und woran denkt er? – Null Antwort. Ein Traum ohne Bedeutung – so ein Gefühl hat man manchmal angesichts unserer Geschichte. Kein Vektor, keine Linie. Die Sprache? Nun ja, doch, durch die starke Senkung der Latte wird sie immer mehr die Sprache windiger Gesellen, parasitärer Projekte. Und so lesen wir schon in der kostenlosen Zeitung, aus der die Bewohner unserer Stadt von allem in der Welt erfahren (eine Buchhandlung gibt es nicht), dass „Natalja Gontscharowa Alexander Puschkins Frau war“. Wie soll man erklären, dass das nicht geht, dass der respektlose Name „Alexander Puschkin“ (ohne Nennung des Vatersnamens Sergejewitsch) nur für einen Dampfer taugt.
Es steht geschrieben: „Wollestu die vmbringen / vnd dem Ort nicht vergeben vmb funffzig Gerechter willen / die drinnen weren?“ Die Gerechten lassen wir in Ruhe, ob einfach gute Menschen reichen? Oder „liebeten“ wir wirklich „die Finsternis mehr denn das Liecht“? „Russland geht zugrunde“, sagte Vater Ilja, als er in der Ortskirche predigte. „Der Mann trinkt und schlägt zu, der Sohn trinkt und schlägt zu, der Enkel trinkt und schlägt zu“, so der Gegenstand der Beichten der armen Frauen der Gemeinde. Wäre es nicht eine gute nationale Idee, dem eigenen Alkoholismus den Kampf anzusagen? Zu wenig Kindliches, Kreatives, Echtes, wenn auch Ungereimtes, dafür viel zu viel sogenanntes Männliches, Reifes, fast immer Überreifes. Schwere Luft, sie haben zu viel getrunken und geraucht, schlimme Unendlichkeit, das Treffen macht schon keine Freude mehr, man hätte längst auseinandergehen müssen, doch die bis zum Gürtel nackten Männer sitzen da, essen kaltes Huhn, das einem menschlichen Handgelenk ähnelt – so sehen unsere Gelage oft aus.
Und morgens klopft ihm die Frau oder Tochter oder beispielsweise die Krankenschwester auf die Schulter: „Du bist heute gut drauf.“ Diesmal hat er es geschafft und ist nicht der Sucht erlegen. Der Alkohol, das ist unser Schlachtfeld. Liebe, Hass, Verlangen, Abstoßung – alles zusammen. Versuch des Zusammenlebens. Der Alkoholismus ist nicht pittoresk, nicht asketisch wie bei Wenja Jerofejew, nicht wie vor kurzem in der Moskauer U-Bahn: „Spenden Sie zehn Rubel für die Entwicklung des vaterländischen Alkoholismus!“ Im Krankenhaus gibt es keine traditionellen Ablenkungen für Männer: weder Fußball im Fernsehen noch Domino, das zieht nicht mehr. Der Alkohol ist allgegenwärtig, spielt eine Rolle im Schicksal fast jeder Familie. Wir geben die Macht des Alkoholismus über uns zu, und wir geben sie nicht zu. Die Haupttugend ist wie bei den alten Griechen nicht Heiligkeit, sondern Maßhalten, so einer „versteht zu trinken“. Wenn er nicht aufhören kann, ist das ein Sieg für ihn, für den Alkoholismus.
Der Trinkanfall beginnt so: Man betrinkt sich bis zur Gefühllosigkeit, ist bewusstlos (ja, ist bewusstlos, nicht dass man einschliefe, um aufzuwachen und zu bereuen), zwei, drei, vier Stunden danach kommt man zu sich, immer noch betrunken, sucht etwas zu trinken, findet es immer, trinkt erneut, so viel man kann (so viel, wie da ist), wird wieder bewusstlos und so weiter, bis ein gewaltsames Ereignis von außen den Zyklus unterbricht (die Miliz sammelt einen auf, man wird zu Hause eingesperrt), oder es wird einem so schlecht, dass man nicht nur nicht trinken, sondern die Hand nicht mehr heben kann. Dann wird man ins Krankenhaus gebracht und gefesselt, damit man, wenn man ins Delirium tremens fällt, nicht aus dem Fenster springt.
Aber das Unglück ist nicht nur das anfallsweise Trinken, nicht die Schädlichkeit für die Gesundheit, nicht die Tatsache, dass ein Teil des Lebens ausgeschaltet, verloren ist. Das Unglück ist die Unaufhörlichkeit des Dialogs mit dem Alkohol, das ganze Leben geht für ihn drauf. Das ist wie der Dialog mit der eigenen Müdigkeit, Schlaffheit, Faulheit, Verzagtheit, nur dass es da keinen Sieg geben kann, sondern bestenfalls: Es blieb im Rahmen. Aber „die Menschen liebeten die Finsternis mehr denn das Liecht“ … Ein Dialog mit dem Abgrund, der immer größer und größer wird. Dieser Abgrund verschlingt die Arbeit, die Liebe, alle Bindungen der Welt. Das Leben verschwindet wie hinter Watte. Der Streit wird nicht gegen das Jahrhundert, die Menschen, das Leben geführt – sondern gegen den Tod, den Abgrund, gegen ihn, den Alkohol. Und vielleicht sollte man von den Traditionen der großen russischen Literatur abweichen und nicht in jedem die Tiefe Dostojewskijs suchen (wenn man gräbt, offenbart sich da wer weiß was …), sondern einfach medizinisch konstatieren: Der ist ein Alkoholiker, ein Verwahrloster, ein Dummkopf?
Woran denken meine Patienten? Das ist mir ein Rätsel. Das ist keine Frage der Bildung. Da sitzt einer vor mir, lauscht und lauscht, ich rede wie gewohnt erregt über die Notwendigkeit, abzunehmen, sich zu bewegen, die Tabletten einzunehmen, selbst dann, wenn es ihm besser geht, will derjenige nur eins: dass ich schweige und ihn nach Hause lasse. Manchmal sagt er zerstreut etwas über den Status des Schwerbehinderten, bittet um eine Bescheinigung. Ich antworte: „Wem wollen Sie sie denn zeigen, dem Apostel Petrus?“ Er lächelt, selbst wenn er nichts verstanden hat. Was geht in seinem Kopf vor? Wahrscheinlich dasselbe wie in meinem, wenn ich bei irgendwelchen Elektrizitätsgesellschaften sitze und man mich rügt, weil ich nicht bezahlt habe: Ich verstehe nichts von den Tarifen und Strafen und warum man bis zum Fünfundzwanzigsten des Monats zahlen muss und will nur schnellstens meine Freiheit. Im einen Fall geht es um Elektrizität, im anderen um das Leben, aber zu verstehen ist der Mann. Ich habe noch nie eine so interessante Arbeit gehabt.
Читать дальше