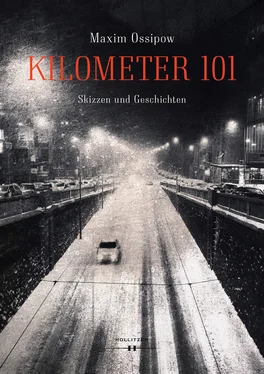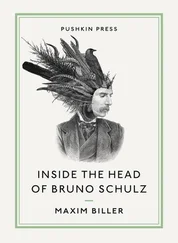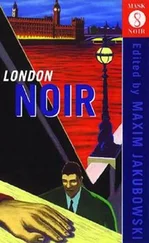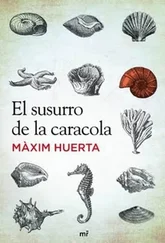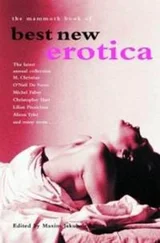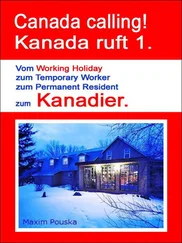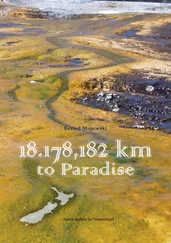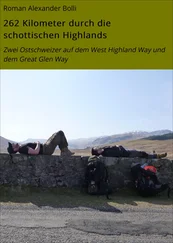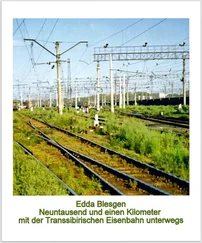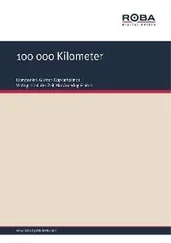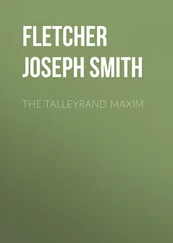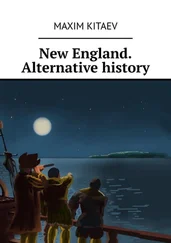Nach zwei Monaten ist sie wieder da, betrunken (sie sagt, sie hat nur Bier getrunken, wenig glaubhaft), sie hat sich ganz schön den Bauch aufgeschnitten, wir haben es genäht. Sie sieht schon gröber aus. Stöhnt vor Schmerzen: „Dieser bescheuerte Husten.“ Dem Anschein nach ist sie ein Opfer, aber sie kann in Zukunft fast alles Böse tun, beispielsweise ihren Mann oder das Kind oder mich erstechen. Es wäre am einfachsten, Olja für psychisch krank zu erklären (obwohl sie keine Fantasien und Halluzinationen hat, doch die Frage, was die Seele ist, gilt in der Psychiatrie als unanständig), aber erklärt das etwas? Du schaust Olja an – und es ist klar, dass das Böse für diesen Menschen nicht charakteristisch ist, sondern in ihn eindringt, in ihn hineinfährt und die Leere, den Zwischenzellraum ausfüllt. Das Böse und das Gute sind von unterschiedlicher Natur, aber die Leere hat nun mal eine Affinität zum Bösen. (Vor kurzem erfuhr die Geschichte der Olja M. eine Fortsetzung. Ihr Mann, der Trinker, kam ins Krankenhaus. Er hatte eine Schnittwunde am Bauch mit Verletzung des Dünndarms und einer Iliakalarterie. Er behauptet, seine Hand sei vom Fleischwolf abgerutscht, er sei gegen den Tisch geprallt, auf dem ein Messer lag und so weiter).
Es gibt auch weniger schwere Begegnungen. In der Stadt N. geht man sehr viel besser als in Moskau mit Menschen um, deren Überleben gefährdet ist, insbesondere mit Obdachlosen. Vor kurzem fuhr der Krankenwagen bei bitterem Frost los, um eine „kriminelle Leiche“ zu holen. „Es sieht so aus, als wäre Sascha Terechow endlich entschlafen“, so drückte es die Arzthelferin aus. Während sie unterwegs waren, setzte sich der lebende Leichnam in ein Taxi, erschien im Krankenhaus und täuschte Atemnot vor. Er kam in das „soziale Bett“, am nächsten Morgen war er verschwunden. Ein anderer Obdachloser, einer der längst russifizierten Deutschen, mit schwerer Aorteninsuffizienz, wohnt schon seit drei Monaten im Krankenhaus, weil man ihn nirgendwohin entlassen kann. Äußerlich hat er sich aus einem Penner und Alkoholiker in einen anständig aussehenden Mann verwandelt, der nicht trinkt, mit Bärtchen und Stock. In dieser Zeit kam seine Exfrau ins Krankenhaus, er bat, sie möglichst lange dazubehalten: Ihre (gemeinsamen) kleinen Kinder kamen zu Besuch. Er nahm siebzig Rubel für einen Umschlag, er will nach Deutschland schreiben, schließlich ist er ein Deutscher und weiß, an wen er schreiben muss.
In einigen Moskauer Krankenhäusern geht man folgendermaßen vor: Nach drei Tagen im Krankenhaus werden die Landstreicher in einen Bus gesetzt und möglichst weit entfernt vom Krankenhaus ausgesetzt, es gibt tatsächlich Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind.
Auch das Lustige bleibt, obwohl es weniger auffällt, weil es sich wiederholt. Neulich brachte mir eine Patientin als Geschenk ein Dreiliterglas Gurken, sie preist die Gürkchen an, ich bedanke mich bei ihr. Auf einmal fragt sie nach: „Maxim Alexandrowitsch, und wie machen wir es mit dem Glas?“
Aktives, bewusstes Böses sehe ich überhaupt nicht, nur die Leere. Auf dem Krankenhausklo liegen Bruchstücke eines Kreuzworträtsels (Patienten wie Mitarbeiter lösen viele solcher Rätsel): „erbärmliche Menschen“, Wort mit vier Buchstaben. Eine Frau hatte ordentlich eingetragen: VOLK (die Autoren des Kreuzworträtsels meinten eigentlich: „Pack“). Ich habe dieses Wort immer gemieden, noch vor der Ankunft in N., doch ich habe mich in vieler Hinsicht stark getäuscht. (Brodsky über Solschenizyn: „Er dachte, der Grund ist der Kommunismus. Er versteht nicht, dass der Grund der Mensch ist.“) Man kann das sogenannte „Volk“ nicht wie kleine Kinder behandeln: in der Mehrheit sind das erwachsene, verantwortliche Menschen. Jedenfalls habe ich bei näherer Bekanntschaft mit ihm keinerlei Gefühl des Verlustes oder nicht verwirklichter Möglichkeiten gefunden. Sie sind wirklich bereit, fünfzig, sechzig Jahre zu leben – also kürzer als im Westen –, die Brücke „war nicht da, und wir brauchen auch keine“, sie ziehen wirklich die billige Popmusik Beethoven vor: Zu dem von uns organsierten Benefizkonzert kamen fast ausschließlich Datschniki. (Apropos: Der Hass auf die klassische Musik – trotz ihrer riesigen Erfolge – ist ein unerklärliches Phänomen. Meinem Bekannten, einem Musiker, der in die Psychiatrie musste, erlaubte man nicht, seinen Plattenspieler zu benutzen – er sollte keine klassische Musik hören, da die selbst schizophren sei. Den anderen Patienten erlaubte man es, weil sie „normale“ Musik hörten, sprich: Humtata-Humtata.) Die aktuellste Erzählung Tschechows ist trotzdem „Das neue Landhaus“ und nicht „In der Schlucht“. Da wählen die Leute aus ihrer Mitte – unter den Bedingungen ganz realer Autonomie – die Lytschkows.
DIE OBRIGKEIT (die, zu denen man nicht „nein“ sagen kann).
Ein einfacher Sowjetmensch und ein einfacher sowjetischer Sekretär der Kreisleitung, das waren sehr verschiedene Leute. Dieser Unterschied gilt noch jetzt. Lytschkow, der alle fertigmacht, die ihn stören, und auch noch legal gewählt ist, ist natürlich sehr dumm nach den Maßstäben eines Intellektuellen (was sollte es sonst für Maßstäbe geben?), aber er hat ein feines Gespür. Ich rede mit ihm, doch in meinen Augen steht geschrieben: „Ich brauche deine Unterschrift so dringend, dass ich sogar bereit bin, mit dir einen zu trinken.“ Er hat nichts dagegen, einen zu trinken, aber nicht unter diesen Bedingungen.
Mit der Obrigkeit sind viele Geschichten verknüpft, keine ist erfreulich, zwei wunderten mich. Die erste: Ich bat eine große westliche Firma, mir eine Rechnung über einen CT-Scanner auszustellen (Förderer hatten versprochen, ihn zu bezahlen), und zwar zu seinem echten Preis – für eine halbe Million und nicht für eine Million Dollar, ohne Schmiergeld. Sie redeten lange auf mich ein: Mit der Differenz können Sie noch andere Apparate kaufen (hm, ja, und die bringen ebenfalls Schmiergeld und so weiter bis zu Kopfkissenbezügen und chirurgischen Nadeln). Deshalb ist im Russischen das äußerst dehnbare Verb durchölen aufgetaucht, das heißt, für alles und jeden Geldaufschläge zahlen. Dann kam heraus, dass man den CT-Scanner ohne Schmiergeld nicht kaufen kann: Die Obrigkeit stünde in einem schlechten Licht da. Obwohl man bei Rot nicht fahren darf, ist das also die einzige Möglichkeit, ans Ziel zu kommen.
Die zweite Geschichte passierte, als ich mir bekannte einflussreiche Ärzte bat, mich vor der Obrigkeit in Schutz zu nehmen. „Kein Problem. Sag, wen wir anrufen sollen, wir regeln alles.“ Ich frage, wie. „Ehrlich gesagt, wir drohen normalerweise mit einer physischen Strafaktion“ (mithilfe früher einmal kurierter Banditen). Ich drossele schnell das Gespräch und schneide ein neues an: über Infarkte, Schlaganfälle und andere liebe Dinge.
All das bekümmerte mich stark, aber dann sah ich das Problem mit anderen Augen. Die Schwierigkeit ist nicht, dass „man in diesem Land nichts machen kann“ (schließlich hat man dort eine Revolution machen können), sondern dass meine Sprache ihnen genauso unverständlich ist wie mir die ihre. „Patient, was heißt, Schuster, bleib bei deinen Leisten?“ „Ich bin gar kein Schuster“, das ist aus dem Lehrbuch für Psychiatrie. So halten wir es auch mit der Obrigkeit. „Sie sind doch ein Staatsmann“, sage ich zu einem großen Bonzen. Antwortet der doch: „Staat – das ist ein relativer Begriff.“
Da gibt es zwei Wege. Der erste: eine neue Sprache lernen, was schwierig ist und wozu ich keine Lust habe, zumal sie meiner Muttersprache so ähnlich ist, dass man womöglich alles durcheinanderbringt. Da gibt es nicht nur „ich werde Sie anrufen“, „Bleiben Sie bitte in der Leitung“, „das kostet zu viel“, „zum Erfolg verurteilt“, „das wird nachgefragt“, „keine Rechtsgrundlage“, „schlechte Ökologie“, „Unterfinanzierung“, „Realisierung von nationalen Projekten“ – es geht um ein System von Begriffen und die Arten des Beweises. Was ich sage, hat absolut nichts mit dem zu tun, was ich als Antwort zu hören bekomme. Die Obrigkeit hat denselben Eindruck, denke ich. Der zweite Weg – nacheinander auf alle Knöpfe drücken wie bei einem unbekannten Computerprogramm, das ist häufig erfolgversprechend. Also machen wir das.
Читать дальше