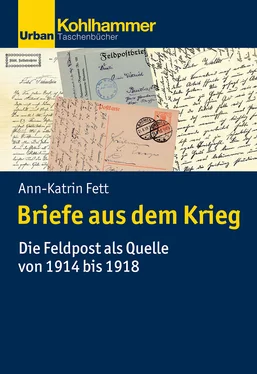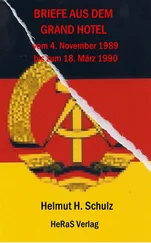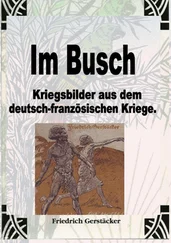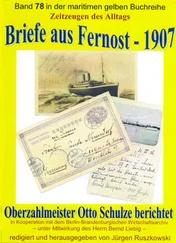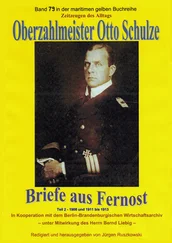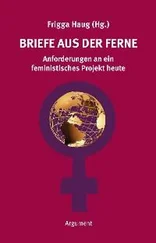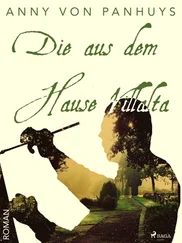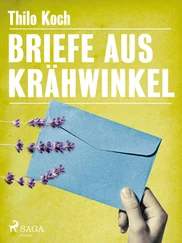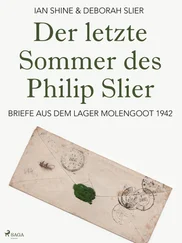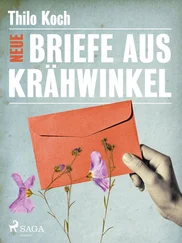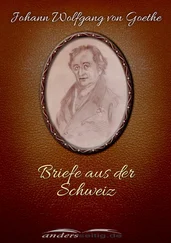Gustav Lehmanns Brief vereint zahlreiche Diskurse und Deutungsangebote des Ersten Weltkriegs und stellt ein Konglomerat aus religiösen, fatalistischen, nationalistischen und chauvinistischen Motiven dar. Zu Beginn des Briefes wird der Topos von der männlichen Frontgemeinschaft beschworen, die sich klar von den zivilen Bindungen zu Familienmitgliedern oder Ehefrauen abgrenzt und der die Soldaten oft eine tiefere, beinahe schicksalhafte Bedeutung zuschreiben. Eng damit verbunden ist die Überzeugung, man könne den Daheimgebliebenen aufgrund divergierender Erfahrungswelten weder das Erlebte im Krieg noch die große Relevanz der soldatischen Gemeinschaft beschreiben. Auf diskursiver Ebene werden auf diese Weise die Gräben zwischen Front und Heimat, zwischen Soldaten und Zivilisten, zwischen Männern und Frauen konstruiert und festgeschrieben. Gustav Lehmanns Brief deutet an, dass in der Vorstellung mancher Soldaten die soldatischen Männerfreundschaften nicht nur Familienbande ersetzen, sondern zugleich Frauen ausschließen: Weiblich konnotierte Verhaltensweisen wie die fürsorgliche Liebe oder das Spenden von emotionaler Nähe und Trost werden von den Soldaten selbst übernommen. 41So betont Lehmann etwa das brüderliche Einverständnis und Vertrauen, das zwischen ihm und Walter herrschte und das vom Teilen materieller Güter bis hin zum gegenseitigen Wärmen in der Kälte reichte. Die Ausnahmesituation an der Front legitimiert emotionale und feminin besetzte Verhaltensweisen, die innerhalb der starren Geschlechtergrenzen der Vorkriegszeit kaum sagbar gewesen wären. 42Zugleich unterstützt Lehmann jedoch eben jene genderbezogenen Differenzen, indem er an Ellas Rolle als Frau, und wichtiger noch, als deutsche Frau appelliert: Schicksalsergeben soll sie den Tod ihres Verlobten hinnehmen und in diesem Opfer ihren spezifisch weiblichen Beitrag zum deutschen Kriegserfolg sehen. Eine individuelle Trauer als Privatperson steht ihr nicht zu, schließlich erleiden Tausende dasselbe Schicksal wie sie. Diese Argumentationsweise geht mit der Überzeugung einher, dass der oder die Einzelne in ein überpersönliches Kollektiv eingebunden ist und dem Sterben im Krieg somit eine höhere Bedeutung zukommt: Walters Tod, der in Lehmanns Brief nicht nur zur Berufung, sondern gleich zum schönsten Tod von allen stilisiert wird, war nicht umsonst, da er im Dienst einer – nicht näher definierten – übergeordneten Sache stand. Das Opfernarrativ, welches sich sowohl auf den toten Soldaten als auch dessen trauernde Verlobte bezieht, ist untrennbar mit einem gesteigerten Pflichtgefühl verbunden. Dieses klingt in vielen Feldpostbriefen des Ersten Weltkriegs an und steht in einer Reihe mit einer meist unreflektierten Kriegsentschlossenheit. Der Pflichtbegriff manifestiert sich jedoch für Frauen und Männer auf unterschiedliche Weise: Die männliche Pflicht besteht in der Verteidigung des Vaterlands auf dem Schlachtfeld und im Extremfall im Opfertod, während die weibliche Pflicht in einem passiven Hinnehmen des Verlusts und einem Fügen in die Rolle als Frau besteht. Der weibliche Beitrag zum erhofften Sieg ist zwar unabdingbar, wird jedoch stets als sekundär im Vergleich zum männlichen Kriegsopfer gesehen. 43
Darüber hinaus stellt Lehmann eine Analogie zwischen Walters Sterben und der Passion Christi her: So wie sich Christus für die Menschheit opferte, starb auch Walter einen religiös konnotierten Opfertod, der einem göttlichen Ziel diente. Bezeichnenderweise wird der Leidensweg Christi mit Kriegsterminologie beschrieben, was einmal mehr die Nähe von religiösen und kriegsimmanenten Diskursen belegt: Jesus habe die größte Schlacht auf Erden geschlagen. Anders als die Soldaten, die in Schützengräben ausharren müssen, entschied er diese jedoch nicht mit Waffengewalt für sich, sondern mit seinem großen Selbstopfer, welches zu guter Letzt die Rettung der Menschheit sein wird. Lehmanns Ausführungen sind von einer fehlerhaften Orthographie und sprunghaften Assoziationen durchzogen. Atemlos betont er, ein jeder müsse sich seinem gottgewollten Schicksal fügen, vor dem es kein Entrinnen gebe. Der Brief schließt mit einem floskelhaften und für die Empfängerin wohl wenig befriedigenden Verweis auf den heilsbringenden Tröster und wirft noch einmal das Schlagwort der Pflicht in den Raum.
Häufig liegen zudem Existenzielles und trivial wirkende Alltagsthemen eng beieinander, wie folgende Feldpostkarte zeigt:
»Habe deine Karte vorgestern erhalten. Es freut mich sehr, das du noch lebst. Herr Husmann ist auch da gewesen mit 50 Autos, mit Liebesgaben.« 44
Im zeitgenössischen Bewusstsein findet selten eine strikte Trennung zwischen alltagsrelevanten und existenziellen Diskursen statt. Es lässt sich zwar eine gewisse Distanz zum Tod feststellen, allerdings deutet dies nicht auf eine Tabuisierung desselben hin, sondern auf einen pragmatischen Umgang mit diesem allgegenwärtigen Thema. Zum einen erschwert der begrenzte Umfang einer Feldpostkarte detaillierte Darstellungen tiefgründiger Themen. Zum anderen hat sich am Anfang des Krieges noch keine adäquate sprachliche Darstellungsform für das zuvor nie gekannte Phänomen des massenhaften Sterbens und Tötens etabliert: 1914 wird das Thema Tod in Ermangelung an sprachlichen Alternativen noch in bekannte und tradierte Sinnstrukturen eingebunden. Dabei ist auffällig, dass zwar die Todesursachen sowie die Waffen, welche die tödlichen Verletzungen auslösen, in den Briefen erwähnt werden. Der Gegner bleibt jedoch meist unsichtbar. Dadurch entsteht der Eindruck, die Kriegsmaschinerie habe ein überpersönliches Eigenleben entwickelt und agiere losgelöst von den teilnehmenden Soldaten, die unbekannten Mächten ausgeliefert sind und keinerlei Handlungsspielraum haben. Dieses Phänomen des abwesenden Gegners schließt außerdem ein, dass zwar das Sterben, nicht aber das aktive Töten in den Feldpostbriefen thematisiert wird: Eine »Auseinandersetzung mit dem Zufügen von Gewalt im Sinne einer aktiven Täterschaft« 45fehlt beinahe komplett. Die Soldaten schreiben sich zwar in einen Opferdiskurs ein und reflektieren über den Tod im Krieg, treten in den Feldpostbriefen jedoch so gut wie nie als Täter in Erscheinung. Neben einem offensichtlichen Verdrängungsmechanismus ist der Grund hierfür in der bereits zu Kriegsbeginn weit verbreiteten Auffassung des Krieges als plötzlich hereinbrechende Katastrophe zu suchen. Da in den Briefen selten über Kriegsursachen und Verantwortungen nachgedacht wird, liegt es den meisten Briefschreibern fern, die eigene Rolle in diesem Krieg zu hinterfragen oder gar über die eigene Mitschuld zu reflektieren. Die fehlende Reflexion über die eigene Täterschaft lässt sich zudem mit der allgemeinen Unsichtbarkeit des Gegners erklären: In einem industrialisierten Krieg, in dem der Mensch gegenüber den maschinellen Waffen eine untergeordnete Rolle einnimmt, tritt der Gegner weder als aktiver Täter noch als Opfer in Erscheinung.
Im Dezember 1914 schreibt ein Soldat einen Brief an eine Gruppe von Freunden:
»Es freut mich jedesmal, wenn ich von meinen ehemaligen Quartierleuten etwas höre u. immer wird mirs weh ums Herz wenn ich an die schöne Zeit denke, die ich bei Euch erlebt habe. Aber auch die guten Vesperle habe ich noch nicht vergessen, ohne die wäre ich schwerlich ins Feld gekommen, denn von der Kaserne weg, war ich nicht gar so stark. Lassen wir aber nun die Vergangenheit ruhen u. denken wir an die Gegenwart u. Zukunft. Die Gegenwart ist schrecklich u. die Zukunft male ich mir auch nicht so rosig aus, wie lange wirds noch dauern, dann stehe ich schon wieder in diesem mörderischen Feuer, das keine Barmherzigkeit kennt, aber man kanns halt nicht ändern, das beste ist, man nimmt alles hin, wies kommt.« 46
Feldpost spielt eine zentrale Rolle für die Aufrechterhaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen sowie das Erschaffen von gedanklichen Gegenwelten zum Chaos im Krieg. Wehmütig schwelgt der Briefschreiber in Erinnerungen und beschwört vergangene Zeiten, die der Krieg unwiederbringlich zerstört hat. Seine resignierte Analyse von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigt, dass bereits 1914 Kriegsmüdigkeit und Zukunftspessimismus weit verbreitet waren. Fast immer ist die Verbitterung über die gegenwärtige Lage mit fatalistischen Floskeln verbunden, die zum Aushalten und Hinnehmen auffordern. Die Gleichsetzung des Krieges mit einem erbarmungslosen Höllenfeuer ist dem religiösen Wortfeld entlehnt und verdeutlicht, dass viele Briefschreiber auf kulturell überlieferte Metaphern zurückgreifen, um ihren Mitmenschen die Situation, in der sie sich gegenwärtig befinden, zu verdeutlichen. Der folgende Auszug verzichtet jedoch auf anschauliche Sprachbilder und spielt stattdessen auf die Nichtdarstellbarkeit des Krieges an: »Wie der Krieg so vor sich geht könnt ihr euch garnicht denken es ist schrecklich, darum auf ein gesundes Wiedersehen.« 47Der bewusste Verzicht auf eine Beschreibung der gegenwärtigen Lage geschieht unter der im Ersten Weltkrieg weit verbreiteten Prämisse, dass das Kriegsgeschehen mit Sprache nicht angemessen ausgedrückt werden kann und daher die Angehörigen, die sich in einer anderen Erfahrungswelt befinden als der Schreiber, das Dargestellte nicht verstehen können. So beschränkt sich der Briefschreiber auf das Adjektiv ›schrecklich‹, das zwar vage bleibt, zugleich jedoch eine Vielzahl von Assoziationen hervorruft. Hierbei ist zu betonen, dass die Menschen, abhängig davon, ob sie sich an der Front oder in der Heimat befinden, zwar unterschiedliche Erfahrungen machen, aufgrund der stetigen Briefkommunikation jedoch eng aufeinander bezogen bleiben. Von einem Entfremdungsprozess zwischen Front und Heimat kann deshalb zu Beginn des Krieges nur bedingt die Rede sein. 48
Читать дальше