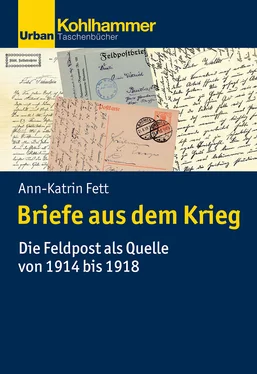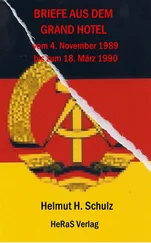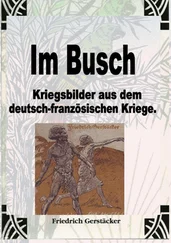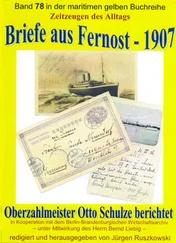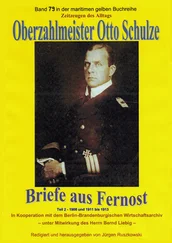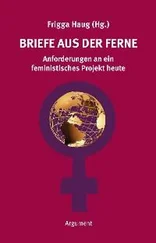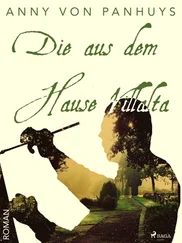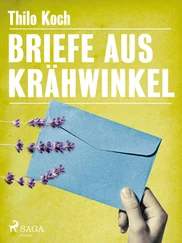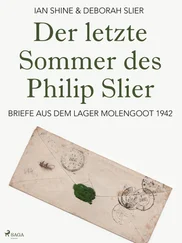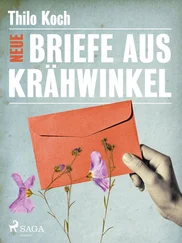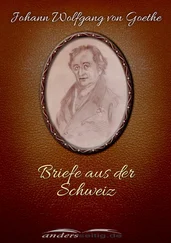Die weit verbreitete Verunsicherung bezüglich der sich überschlagenden Ereignisse manifestiert sich in den Briefen und Karten in einem lakonischen Stil. Im September 1914 berichtet ein Soldat von seiner Ausbildung, die in aller Eile durchgeführt wird:
»Wier müssen am Morgen um 5 Uhr aufstehen, u. ausrücken bis ½ 12 Uhr, dann von ½ 3–8 Uhr, das schlaucht nicht wenich. Unser Majohr meint uns daß wier in 4 Wochen ausgebildet sein sollen, dann geht nach Münsingen u. Scharfschießen, u dann geht’s Rußland zu […].« 4
Dem Medium der Feldpostkarte ist es geschuldet, dass einschneidende biographische Ereignisse wie die Fahrt nach Russland auf knappe Eckdaten reduziert werden und so die existenzielle Dimension des Mitgeteilten nur erahnt werden kann. Ausschlaggebend ist außerdem die Tatsache, dass – je nach Milieuzugehörigkeit und Bildungsgrad – das schriftliche Ausdrucksvermögen vieler Menschen aufgrund fehlender Schreiberfahrung in der Vorkriegszeit schnell an seine Grenzen stößt. 5Zudem liegt die Vermutung nahe, dass selbst erfahrenere Briefschreiberinnen und Briefschreiber oft nicht imstande waren, die völlig neue Erfahrung eines Krieges in schriftliche Sinnzusammenhänge zu stellen. Eine persönliche Ebene, die Einblicke in das innerste Empfinden der Schreibenden gewährt, findet sich in den untersuchten Briefen und Postkarten somit äußerst selten:
»Wir rücken bis 15. aus nach der Grenze. Schreibe mir bald einmal. Gott schütze dich.« 6
Während sich aus diesen drei kurzen Sätzen, die ein Soldat Anfang August auf einer Feldpostkarte an einen Freund richtet, keinerlei Rückschlüsse auf die emotionalen Vorgänge des Briefschreibers ziehen lassen, sind diese doch symptomatisch für die sprachlichen Diskurse und Briefkonventionen der damaligen Zeit. Die Aufforderung, bald zu schreiben, zeigt, dass die primäre Aufgabe der Feldpost nicht der detaillierte Austausch von Informationen, sondern die Aufrechterhaltung von persönlichem Kontakt war. Die Wendung »Gott schütze dich« am Ende der Postkarte erhält durch ihre Formelhaftigkeit beschwörenden Charakter. Dies zeigt sich auch in folgendem Brief, den eine Mutter Ende August an ihren Sohn richtet:
»Lieber Ernst ich bete Tag und Nacht für Euch lieben Kinder, das Euch der liebe Gott überall beschützen mag wo ihr seid. Friedrich hat ein Testament gemacht falls er nicht wieder kömmt, mir das Haus gehört, ich damit machen kann was ich will ist das nicht braf von ihn.« 7
Der Verweis auf das tägliche Gebet kann als Bewältigungsstrategie verstanden werden, die in den traditionellen Formen der Religiosität verhaftet ist, und der Briefschreiberin angesichts der verunsichernden Ereignisse Orientierung vermittelt. Auch das erwähnte Testament ist weit mehr als eine bloße finanzielle Absicherung, zeugt es doch von dem Bedürfnis, in einer unüberschaubaren Situation mit ungewissem Ausgang die Kontrolle zu behalten.
Das disruptive Potential des Krieges, der die Fundamente des bisherigen Lebens erschüttert, ist eng verknüpft mit einer unbestimmten Endzeitstimmung. Anders jedoch als in vielen literarischen Werken, die auf die Zeit der Mobilmachung Bezug nehmen, ist in den Feldpostbriefen von einem heilsgeschichtlichen Erneuerungsgedanken oder gar von Kriegsbegeisterung nichts zu spüren. Während etwa in Thomas Manns Der Zauberberg der Krieg als reinigender Donnerschlag bezeichnet wird, der die Welt ins Chaos stürzt, nur um aus ihren Trümmern »einmal die Liebe steigen« 8zu lassen, ist in den Briefen oft eine gänzlich profane Zukunftsangst sowie der damit verbundene Wunsch nach Absicherung vorherrschend: Der bereits erwähnte Wilhelm habe seiner Schwester geraten, »sie sollten sich trauen lassen, Papiere und Aufgebot brauchen sie jetzt ja nicht, dann kriegt Auguste doch im Notfall Unterstützung […].« 9Und während Emil Sinclair in Hermann Hesses Demian das Motiv des Riesenvogels Abraxas beschwört, der sich schicksalhaft aus dem Ei kämpft – »das Ei war die Welt, und die Welt mußte in Trümmer gehen« 10–, schreibt eine Frau angesichts der Tatsache, dass ihre beiden Brüder in den Krieg gezogen sind: »Hoffentlich sind sie noch gesund und munter dies ist eine zu traurige Zeit für uns alle.« 11In den Feldpostbriefen ist das in der Literatur weit verbreitete reinigende Erweckungserlebnis fast komplett abwesend. 12Der Topos von der alten Welt, die in einem karnevalesken »Weltfest des Todes« 13zugrunde gehen muss, damit aus ihren Trümmern eine geläuterte und bessere Menschheit entstehen kann, ist lediglich in intellektuellen und künstlerischen Kreisen verbreitet, die sich vom Krieg eine Befreiung aus erstarrten gesellschaftlichen Strukturen erhofften. In die Lebenswirklichkeit der meisten Milieus – ungeachtet, ob bürgerlich, ländlich oder von Arbeitern dominiert – ist dieser Diskurs kaum vorgedrungen. 14
Lediglich in abgeschwächter und zur Floskel erstarrter Form finden sich Anklänge davon in den Feldpostbriefen und -karten des Kriegsbeginns, die jedoch trotz der scheinbar transportierten Euphorie nicht als Kriegsbegeisterung interpretiert werden sollten. Im August 1914 schreibt ein Soldat an seinen Bruder: »Und jetzt gehts mit frohem Mut. Mit Gott für König und Vaterland.« 15In der sakralisierten Überhöhung der eigenen Nation gehen Religion und Nationalismus eine semantische Verbindung ein und beinhalten einen identitätsstiftenden Effekt: Der Einzelne ist eingebettet in das Kollektiv der Nation, wodurch nicht nur dem eigenen Dasein, sondern auch dem Krieg an sich ein höherer Sinn verliehen wird.

Abb. 4: Gruppenbild württembergischer Soldaten
Angesichts der Mobilmachung greift im August 1914 eine allgemeine Erregung um sich, der sich beinahe niemand entziehen konnte. Doch nur selten war eine überschwängliche, rauschhafte Euphorie die Ursache für die Menschenansammlungen in den großen Städten. Oftmals trieb das Bedürfnis nach Informationen zu den aktuellen Geschehnissen die Menschen auf öffentliche Plätze – ein Phänomen, das jedoch auf die größeren urbanen Zentren des Deutschen Reichs beschränkt blieb. 16Die Feldpostbriefe sind diesbezüglich bemerkenswert vage. So steht auf einer Postkarte aus Straßburg neben der Abbildung des Münsters geschrieben: »Ich habe mich Freiwillig ins Feld gemeldet.« 17Die Beweggründe für diese Handlung gehen aus der Postkarte jedoch nicht hervor. Es steht ein breites Spektrum an Deutungsangeboten zur Verfügung: Statt einer genuinen Kriegsbegeisterung waren oft Gruppenzwang und die damit verbundene »Scham vor dem Nebenmann« 18ausschlaggebende Entscheidungsfaktoren. Derjenige, der sich nicht freiwillig zum Kriegsdienst meldete, lief Gefahr, als feige und unmännlich gebrandmarkt und auf eine semantische Ebene mit den daheimbleibenden Frauen, Alten und Kranken gestellt zu werden. 19Durch die freiwillige Meldung wurde die eigene Männlichkeit unter Beweis gestellt und der Grundstein für die diskursive Gleichsetzungen ›Mann und Front‹ beziehungsweise ›Frau und Heimat‹ gelegt. Viele Freiwillige waren zudem von der Notwendigkeit des Krieges überzeugt und betrachteten ihre Teilnahme am Krieg als nationale Pflicht. 20Eng damit war die Auffassung verknüpft, Deutschland werde der Krieg aufgezwungen und müsse sich entsprechend verteidigen. So wird beispielsweise auf einer Karte vom Oktober 1914 das Motiv vom deutschen Soldaten als »Vaterlandsverteidiger[…]« 21reproduziert und die defensive Rolle des Deutschen Reiches unterstrichen.
Es ist kein Widerspruch, dass trotz alledem ein Großteil der Bevölkerung die Mobilmachung sowie die bevorstehenden Kriegsereignisse als existenzbedrohende Krise empfand. Aus diesem Grund waren körperliche Gebrechen aller Art bereits zu Beginn des Krieges ein willkommener Grund, sich den drohenden Kampfhandlungen zu entziehen. Eine Mutter schreibt im August 1914 an ihren Sohn:
Читать дальше