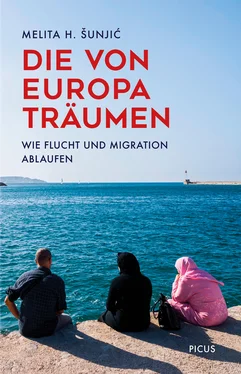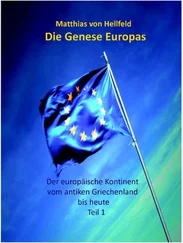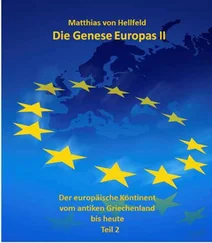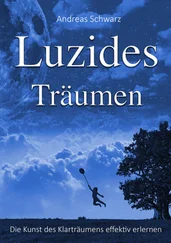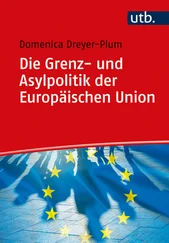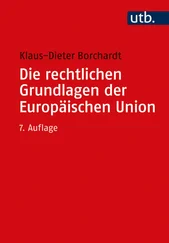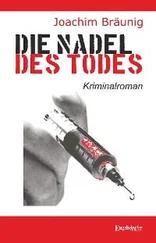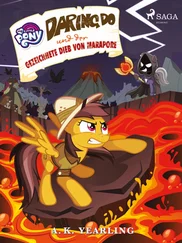Becca versuchte Djamal sanft darauf vorzubereiten, dass sie wohl nie in die Niederlande kommen würden und dass sie sich lieber auf Österreich einstellen sollten, doch er wollte davon nichts hören und wurde manchmal richtig aggressiv. »Was soll ich hier? Ich weiß nichts von Österreich und will da nicht bleiben. Mein Bruder ist in Amsterdam. Da müssen wir hin.«
Auch der Rechtsberater sagte, Djamal müsse mit den Behörden kooperieren, er schade nur sich selbst und seiner Familie mit seinem Trotz und seiner Streitsucht. Doch Djamal war nicht zu beruhigen. Immer wieder schrie er herum, er schimpfte nicht nur auf Frau und Kinder, sondern auch auf die anderen Bewohner und die Betreuer. Immer öfter rutschte ihm die Hand aus, er schlug Becca und die Kinder und wurde mehrere Male von der Heimleitung verwarnt. Einmal kam sogar die Polizei.
Die Sozialarbeiterin des Heimes hatte Becca nach diesem Vorfall zur Seite genommen und ihr erklärt, dass sie auf Wunsch mit ihren Kindern wegziehen könnte. Man würde sie dann weit weg von ihrem Ehemann sicher unterbringen. Sie könnte sich in Österreich auch scheiden lassen. Danach war Becca geschockt. Noch nie hatte sie an Trennung gedacht. Was würde die Familie dazu sagen? Undenkbar. Sie hatte zwar gehört, dass sich in Europa viele Syrerinnen scheiden ließen, aber sie konnte sich das nicht vorstellen. Sie verstand Djamals Frustration und wollte ihm in dieser schweren Zeit beistehen, wie es sich für eine gute Ehefrau gehörte.
Sie waren schon dem Krieg entkommen, hatten gemeinsam die Hölle von Moria und die Schrecken der Balkanroute überstanden. Jetzt gingen die Kinder in die Schule, sie hatten Aussicht auf ein Leben in Frieden, da würde sie die letzten Hürden mit Djamal auch noch nehmen.
Was sollte sie schließlich als geschiedene Frau mit zwei Kindern in einem fremden Land anfangen? Frauen ohne Ehemann lebten ohne Ehre, dachte sie und erinnerte sich an das alte Sprichwort, das ihre Mutter immer zitiert hatte, wenn es um unglückliche Ehefrauen ging: Der Schatten eines Mannes ist besser als der Schatten einer Wand.
BERHANE AUS ERITREA
DIE ZUKUNFTSANGST ALS STÄNDIGE BEGLEITERIN
Drei Jahre hatte Berhane auf dieses Asylinterview gewartet. Jetzt saß der zweiundzwanzigjährige Eritreer vor dem Beamten und der Dolmetscher übersetzte die Frage: »Warum sind Sie nach Italien gekommen? Was hat Sie bewogen, Ihre Heimat zu verlassen?« Berhane hatte gewusst, dass diese Frage kommen würde, er hatte sie erwartet und sich seine Antwort zurechtgelegt. Trotzdem traf sie ihn wie ein Keulenschlag und er begann haltlos zu weinen. Berhane erlitt einen Nervenzusammenbruch und musste ärztlich versorgt werden. Das Interview wurde abgebrochen. Berhane hatte sehr lange auf dieses Asylinterview gewartet, und jetzt konnte es wieder ewig dauern, bis er einen neuen Termin bekam.
Als er von seiner Beruhigungsspritze im Bett des Asylwerberheims aufwachte, schämte er sich. Man zeigte seine Gefühle nicht so offen, schon gar nicht vor Fremden. Aber die Frage hatte so vieles in ihm aufgewühlt und an die Oberfläche geschwemmt.
Er dachte zurück an Eritrea. Seine beiden älteren Brüder waren zum Militär eingezogen worden und nie wieder nach Hause zurückgekehrt. Der eine wurde seit fünf Jahren in einem Bergwerk weit weg von seiner Heimatstadt als billige Arbeitskraft eingesetzt. Sein Militärdienst wurde immer wieder »verlängert«. Als Rekrut musste er von einem geringen Taschengeld leben. Er konnte weder studieren, wie er es vorgehabt hatte, noch seine Verlobte heiraten.
Sein zweiter Bruder war erst vor zwei Jahren eingezogen worden, doch auch seinen Dienst hatten sie verlängert. Er war als Verwaltungskraft in einer Kaserne eingesetzt, aber wenigstens in derselben Stadt wie die Familie.
An Berhanes 17. Geburtstag war ihm nicht nach feiern zumute gewesen. Er hatte Angst vor der Zukunft in Eritrea. Doch er hatte von Europa gehört, davon, wie wunderbar es dort war. So beschloss er, wegzugehen, wie es viele seiner Altersgenossen getan hatten. Nur wenige seiner Freunde besaßen ein Smartphone, aber er hatte doch einige Bilder gesehen, und am meisten hatte ihn ein Selfie beeindruckt, auf dem hinter einem jungen Eritreer eine Straßenszene in Paris zu sehen war. Unter anderem sah man darauf eine freundliche Frau mit einem Hund spazieren gehen. Dort wollte er auch hin, da waren die Leute sicher nett und hilfsbereit und man lebte in Freiheit.
Was hätte Berhane also dem Asylbeamten antworten sollen? »Ich bin gekommen, weil ich ein drohendes Übel gegen das Paradies eintauschen wollte. Und in Wirklichkeit habe ich ein bekanntes Übel durch viele unerwartete und unbekannte Übel ersetzt.« Er stellte sich oft und oft die Frage, ob er richtig gehandelt hatte, ob er gegangen wäre, wenn er gewusst hätte, was auf ihn wartete. Aber er kam zu keinem endgültigen Urteil. Er hatte in Europa noch keinen einzigen Eritreer getroffen, der seine Entscheidung nicht viele Male bereut hatte. Andererseits kannte er keinen Eritreer zu Hause, der zufrieden war und nicht darüber nachdachte, wegzugehen. Es schien ihm manchmal, als könnte man als Eritreer auf Erden nirgendwo glücklich werden.
Zwei Tage nach seinem 17. Geburtstag verabredete sich Berhane mit einigen Freunden. Sie würden sich auf eigene Faust bis Kassala im Osten des Sudan durchschlagen. Dort war es leicht, Schlepper zu finden, die einen weiterbringen würden. Und so war es auch. Ein wenig Geld für die Reise hatte er sich von einem wohlhabenden Verwandten ausgeborgt und war frohen Mutes, dass das für den Schlepper reichen würde.
Sie fanden einen sudanesischen »Reiseleiter« und konnten schon am nächsten Tag in einer größeren Gruppe ihre Reise antreten. Sie gingen zu Fuß und es kostete gar nicht viel. Man marschierte bei Nacht und schlief bei Tag. In Omdurman bekamen sie zwei Tage zum Rasten, dann ging es weiter, in die Sahara. Es war zwar beschwerlich, aber daran stieß Berhane sich nicht, das hatte er erwartet. Die ersten Zweifel stiegen in ihm erst auf, als er entlang des Pfades Leichen und Autowracks liegen sah. Waren das tote Schlepper und ihre Kunden? Der »Reiseleiter« wollte dazu nichts sagen.
Zweieinhalb Tage später kamen der Reisegruppe die libyschen Menschenschmuggler entgegen. Ihre Rucksäcke sowie die Vorräte an Wasser und Nahrung wurden auf einen Kleinlaster geladen. Sie selbst bestiegen einen Lkw, auf dem sich schon andere Somalier und Eritreer befanden und fuhren los.
Einige Stunden döste Berhane vor sich hin, als plötzlich Schüsse zu hören waren. Eine ägyptische Grenzpatrouille hatte sie entdeckt und angegriffen. Die Schlepper erwiderten das Feuer und es kam zu einer regelrechten Verfolgungsjagd. Schließlich befahlen die libyschen Schlepper allen Passagieren abzusteigen und rasten mit dem leeren Lastwagen und dem Kleinlaster mit dem Gepäck davon. Die Reisenden ließen sie einfach zurück, mitten in einem Meer aus Sand, ohne Wasser und ohne Nahrung.
Einige der Mitreisenden waren von den Kugeln getroffen worden. Insgesamt gab es acht Tote und siebzig Überlebende, von denen einige verletzt waren. Die Gruppenmitglieder bemühten sich, alle Toten zu identifizieren. Jene, die einen von ihnen kannten, versprachen, deren Familien zu verständigen, sobald es nur ging. Einige der Toten waren keinem in der Gruppe bekannt.
Mit bloßen Händen schaufelten die Männer Gräber im Sand und bestatteten die Toten so gut sie konnten. Sie waren mitten in der Sahara und einigten sich, dass es besser war, an Ort und Stelle auf die Rückkehr der Schlepper zu warten als planlos durch die Wüste zu irren. Es sollte noch über eine Woche dauern, bis man sie abholte. Jeden Tag begruben sie weitere Reisegefährten und bemühten sich, deren Namen und Heimatstädte auswendig zu lernen, denn sie hatten nichts zum Schreiben. Mit Galgenhumor bemerkte ein Äthiopier unter ihnen, dass hoffentlich der mit dem besten Gedächtnis am längsten überleben würde. Wer es über sich brachte, trank seinen eigenen Urin, um nicht zu verdursten.
Читать дальше