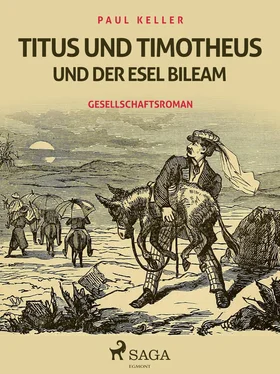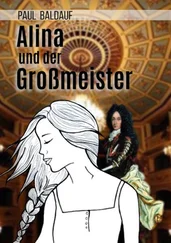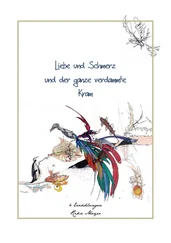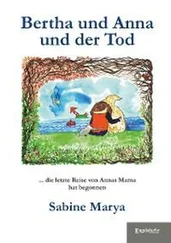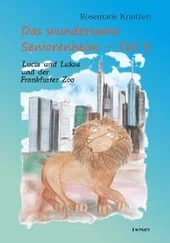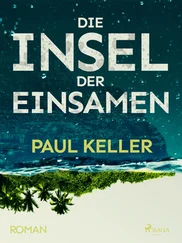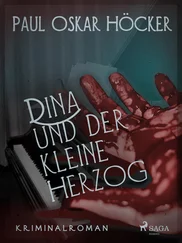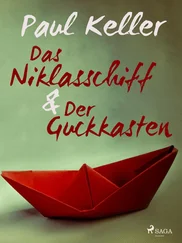Ein silbernes Gelächter schallte über den Zaun.
„Der tolle Brünning bei den Paulusbrüdern!“ rief die blonde Helga.
Alle drei fuhren herum, und alle erkannten das Mädchen. Brünning geriet in Erregung.
„Entschuldigen die Herren, ich muss die Erklärung des Stadtbildes leider abbrechen, ich habe der jungen Dame dort dringend etwas mitzuteilen!“
Er eilte über den Garten, setzte mit einem tollkühnen Sprunge über den hohen Zaun, begrüsste das Mädchen und zog mit ihr lachend den Berg hinab.
Die Paulusjünger standen beklommen da. Timotheus sagte: „Ich hielt diesen Zaun für unüberspringlich; er ist es nicht. Ich wundere mich!“
Titus sagte: „Es war ein turbulenter Einzug. Ich hatte ihn mir weit stiller vorgestellt.“ —
Nun war das neugierige Volk bei eintretender Dunkelheit nach Hause gezogen. Der blaue Schleier der Nacht wehte durch die Bergeinsamkeit und fächelte Kühlung auf alle Stirnen. Am Himmel oben und aus den kleinen Menschenhäusern unten funkelten Sterne.
„Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget.“
„Wir wollen zur Ruhe gehen, denn wir sind weit gewandert.“
In einem gemeinsamen Zimmer war das Harmonium. Auf ihm stand ein Kreuz, umgeben von zwei Kerzen. Titus spielte, die Kerzen brannten, sie sangen einen Abendchoral. Dann reichten sie sich die Hände, und jeder ging in seine Klause. — —
Ach, wohl waren sie müde, aber der Schlaf wollte nicht kommen. Der ernste Gedanke, jetzt hast du an einem neuen fremden Ort deine Hütte gebaut, darin du zu leben entschlossen bist bis an dein Ende, verscheuchte den Schlummer. Die Vergangenheit kam mit ihren alten Bildern, von denen es nun Abschied zu nehmen galt für immer.
Titus starrte nach der dunklen Zimmerdecke, er dachte an Vergangenes. In allen entscheidenden Augenblicken des Lebens kommen die Bilder der Jugend zurück, sogar in das erlöschende Auge eines Sterbenden. Auch vor dem Auge des weltflüchtigen Titus wurden alte Bilder lebendig.
Sein Vater war Arzt gewesen. Er erinnerte sich seiner noch dunkel. Er war ein grosser Mann mit einem Vollbarte. Er hat immer viel Spass mit ihm gemacht, und Titus hatte den lustigen Vater lieber gehabt als die stille Mutter. Sie besassen ein leichtes Wägelchen, das von einem munteren Schimmel gezogen wurde. Mit diesem Gefährt fuhr der Vater zu den Kranken nach den Dörfern. Er nahm den Jungen oft mit. Vor der Tür des Kranken musste der Knabe warten. Er guckte sich dann die Dorfstrasse an, hielt die Pferdeleine und freute sich, wenn vorübergehende Dorfkinder mit einem gewissen Respekte sagten: „Das ist Doktors Junge!“ Einmal ist der Schimmel mit ihm losgegangen, er hatte aus Langweile zu stark an der Leine gezupft. Der Schimmel setzte sich gleich in Trab, und da hörte der Junge auch schon den Vater schreien, und er wusste wohl, dass er dem Wagen nachrannte. Aber der Schimmel hatte einen starken Vorsprung und hatte sich in seinen berühmten „schlanken Trab“ gesetzt. So war für den Vater nichts zu erreichen. Dem kleinen Titus, der damals noch Philipp hiess, fiel ein, er könne die Bremse andrehen, aber die Bremse ging zu schwer, er konnte sie nicht drehen. So musste er weiterfahren. Die Dorfstrasse war belebt, zwei Heufudern musste er ausweichen, zwei Radfahrern, einer Langholzfuhre und einer Herde Gänse. Die Gänse waren das schlimmste Hindernis; denn sie wollten nicht ausweichen. Der Wagen schleuderte, als er durch die kreischende Schar lenkte. Schliesslich gelang es ihm, durch kosende Zurufe das Temperament des Weissen zu sänftigen und ihn durch milde Zusprüche und etliches Leinezupfen zu bewegen, an einer verbreiterten Stelle der Strasse vorsichtig und ganz regelrecht zu wenden und die Dorfstrasse zurückzutrotten. So begegnete er dem Vater, der ausser Atem war. „Du musst nicht böse auf den Schimmel sein, Papa, ich habe an der Leine gezupft, da hat er gedacht, du sitzest schon im Wagen, und ist losgegangen.“
Der Vater sagte nichts als „Gott sei Dank!“ und küsste den Sohn. Dann rief er dem Schimmel zu: „Los, du rasender Renner!“ Sie lachten beide, der Schimmel wieherte, und alle waren herzlich vergnügt. Schön waren diese Besuchsfahrten bei Kranken! Manchmal freilich war es traurig; wenn weinende Verwandte in der Haustür standen und fragten, ob denn gar keine Hoffnung mehr sei, und der Vater bedauernd die Achseln zucken und fortfahren musste. Dann dachte der kleine Junge, es sei eigentlich recht schlimm und traurig auf dieser Erde. Aber öfters noch begleiteten Verwandte den Vater bis zum Wagen, und ihre Gesichter strahlten, und manchmal küssten sie dem Vater die Hände. Dann war der kleine Junge sehr stolz. Welcher Junge in der Stadt hatte wohl einen Vater, dem die Leute die Hände küssten? — Dann kamen die sechs Wochen, wo der Knabe den Vater nie mehr begleiten durfte; da hauste eine Seuche in der Gegend, der Typhus. Der Vater war kaum ein paar Stunden zu Hause, Tag und Nacht war er unterwegs. Und nach sechs Wochen ging der kleine Philipp mit seiner Mutter hinter dem Leichenwagen des Vaters. Die Leute standen am Wege oder gingen hinter dem Sarge, und viele weinten laut und sagten: „Der gute Herr Doktor. Er hat sich geopfert!“ Dann wurde das schöne Haus, der liebe Schimmel und das Wägelchen verkauft, und Philipp zog mit der Mutter in eine kleine Mietswohnung.
Er durchlief die Klassen des heimischen Gymnasiums ohne grosse Mühe und bezog mit neunzehn Jahren die Universität. Seit der Vater tot war, hatte die Mutter, die von jeher still und fromm war, nur noch Gedanken, Sehnsüchte und Hoffnungen, die hinübergingen in das Land der Wiedervereinigung und aller Erfüllung. So war sie glücklich, als ihr Einziger einwilligte, Theologie zu studieren. Er studierte mit allem Eifer und hielt sich von wildem, studentischem Treiben ganz fern. Aber er vergrübelte sich in der Einsamkeit seiner kleinen, kahlen Stube. Ganz und gar der starken Persönlichkeit Luthers verfallen, wollte er sich nicht abfinden mit der Allianz von Lutheranern und Reformierten. Da er nun in seelischen Konflikt mit der evangelischen Landeskirche kam, insonderheit den Fürsten und weltlichen Behörden das Recht abstritt, in religiösen Dingen ein so grosses Wort zu führen, da er insonderheit auch den Satz: „Cuius regio, eius religio,“ von Herzen verwarf, so gab er es auf, ein Diener der evangelischen Glaubensgemeinschaft werden zu wollen; er trat zu den Altlutheranern über, obwohl er ja auch da auf Sätze und Auffassungen stiess, die ihn störten.
Kurz vor dem Wechsel starb seine Mutter. So blieb ihr der Schmerz erspart, ihre Lebenshoffnung zerrinnen zu sehen, die sie bis jetzt aufrecht erhalten hatte, ihren Sohn bei St. Katharina im Heimatstädtchen predigen und ihn den Segen: „Der Herr segne dich und behüte dich!“ singen zu hören.
Auch im altlutherischen Lager fühlte sich Philipp nicht wohl, und so kam er zu der Überzeugung, er sei für den Beruf eines Geistlichen überhaupt nicht geeignet. Im schwarzen Rock aber etwa nur Unterkunft und Versorgung zu suchen, dazu war er zu stolz. So gab er das Studium der Theologie auf. Er besass damals ein ererbtes Vermögen von etwa 20 000 Mark. Von den Zinsen dieses Kapitals, meinte er, würde er bei seinen geringen Ansprüchen ganz gut leben können. Aber er war jung; er wollte arbeiten. Was? Was sollte er arbeiten? Entgleiste Theologen finden sich in der Welt schwer zurecht, denn die Welt sagt: „Fortgelaufene Pfaffen taugen nichts!“, und die Ausbildung ist zu einseitig. Für die realen Bedürfnisse des Tages nicht brauchbar. Philipp Deutschmann war einige Zeit seines Lebens ganz ratlos. Was sollte er nur tun? Arzt hätte er wohl werden mögen, wie sein Vater war, aber wenn er an die stinkende Anatomie und die Schlachtbänke der Operationssäle dachte, die er doch hätte passieren müssen, wurde ihm physisch übel; Jurist wollte er auch nicht werden, die Händeleien vor dem Zivilrichter wollte er nicht übernehmen, noch viel weniger über Leben und Freiheit der Menschen verfügen. Auch zum Lehramt fühlte er sich nicht berufen, obwohl ihm das am meisten gelegen und er diesen schönen Beruf herzlich gern ausgeübt hätte. Aber er hatte in seiner Schule erlebt, dass gutmütige Lehrer meist von den Schülern misshandelt wurden und vor allen Dingen, dass sie nicht die gewünschten Erfolge erzielten. Die richtige Lehrerhand muss weich und warm sein, im Innern aber doch ein unzerbrechliches Stahlwerk haben. Diese Lehrerhand hatte er nicht; der Stahl fehlte, der zupackt, wenn es sein muss. Vielleicht war seine Jugend schuld, dieses immerwährende Alleinsein mit der trauernden Mutter. So war Philipp ratlos. Einem praktischen Berufe getraute er sich erst recht nicht zuzuwenden; er war völlig unpraktisch, es fehlte ihm aller Sinn für reale Erfordernisse und Hilfsmittel zu deren Erfüllung. Für handliche Betätigung war er nun schon gar nicht geschickt. Was sollte er nur tun? War er denn zu gar nichts nutze, war er nur ein lebensuntüchtiger Träumer? Da erinnerte er sich, dass er noch einen lebenden Verwandten habe, der in einer süddeutschen Stadt Goldschmied und Uhrmacher war. Der Verwandte war ein Neffe seines Vaters, also mit ihm Geschwisterkind.
Читать дальше