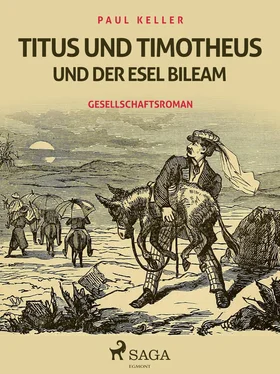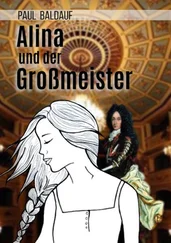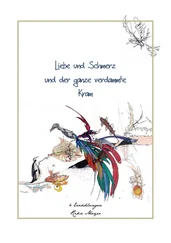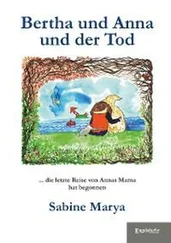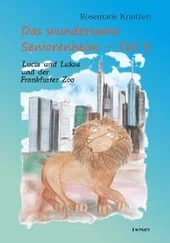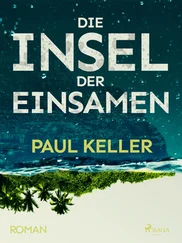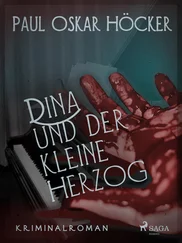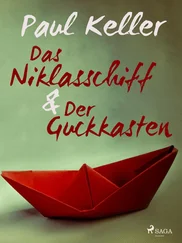„Es ist alles, wie wir es gewünscht haben,“ sagte Timotheus, „Der Agent war eine treue Seele. Sieh das entzückende Strohdach, die kleinen Fenster. Das Storchennest, von dem jenes schwatzhafte Mädchen sprach, ist wirklich da! Kein Zweifel, wir sind am Ziel!“
„Der Garten ist gross, und es stehen schöne Obstbäume darin,“ lobte Titus.
„Ja,“ sagte Timotheus, „und was die Hauptsache ist, um den Garten ist ein so hoher Zaun, wie man ihn selten findet. Darüber springt kein Unbefugter. Lass uns eintreten!“
Am Gartentore, das offen stand, sprachen sie gemeinsam: „Der Herr segne unseren Eingang und unseren Ausgang!“ Dann reichten sie sich die Hände, und Timotheus sagte mit feuchten Augen: „Vereint bis zum Tode, damit wir auch drüben in der Ewigkeit wieder vereint werden, in der wahren Heimat!“
„Ja!“ sagte Titus schlicht und fest.
„Und es wird uns nichts trennen, nicht Hang nach Ruhm oder Geld oder sonst etwas, das die Welt hoch wertet, vor allen Dingen kein Weib!“
„Nichts wird uns trennen!“ sagte Titus.
„Amen!“ sagte Timotheus, und es war wie ein Schwur.
Im Garten trat ihnen eine alte Frau entgegen.
„Was wünschen Sie?“
„Wir sind die neuen Besitzer dieses Anwesens.“
„Sie?“
Der Alten verschlug es die Sprache; sie hätte die beiden viel eher für ausländische Stromer gehalten als für Hauskäufer. Sie fürchtete sich vor den zweien.
„Haben Sie denn etwas Schriftliches?“ fragte sie.
„Jawohl, Grossmutter!“ sagte Timotheus gemütlich. Er ahnte, was in der Greisin vorging, kramte in seiner gewaltigen Handtasche, brachte einen Kaufkontrakt heraus und wies ihn der Alten vor. Diese rückte die Stahlbrille zurecht, las und sagte: „Jawohl, es stimmt! Es stimmt, Herr Weihrauch; es ist schon eine Postkarte für Herrn Weihrauch da, ein Avis vom Güterbahnhof.“
„Unsere Möbel!“ murmelte Titus.
Timotheus aber kriegte Magengrimmen, als er in der neuen Heimat wieder mit seinem bürgerlichen Namen genannt wurde. Furchtbar, dass er ausgerechnet „Weihrauch“ heissen musste; das ist für einen strammen Calvinisten so schrecklich, wie wenn ein strebsamer Bankier von seinen Ahnen den Namen „Schufterle“ ererbt hat, oder wenn ein Arzt „Totengräber“ heisst oder ein Völkischer „Bebel“ oder ein Hotelwirt „Wanzmann“. Solche Namen beissen und brennen. Was Timotheus auch getan hatte, eine Namensänderung zu erzielen, er war abgewiesen worden von den deutschen Behörden, die in konfessionellen Fragen zart und neutral bis zur höchsten Peinlichkeit sind. Timotheus fühlte sich so wohl und geborgen unter seinem schönen Paulinischen Namen und — nun wieder „Herr Weihrauch!“ Wenn Timotheus daran dachte, dass dieser penetrant riechende Name nun seine Familie schon seit vierhundert Jahren belästigte, wenn er gar daran dachte, dass seine Ahnen in vorkalvinischer Zeit vielleicht katholische Messdiener gewesen sein könnten, wurde ihm allemal schlecht. Fehlte bloss noch, dass sein Genosse Titus bürgerlich „Weihwasser“ hiesse, dann wäre der Pechkessel voll. Titus aber hatte einen anständigen Namen; er hiess Philipp Deutschmann.
„Also, Herr Weihrauch, das Avis ist da,“ sagte die beruhigte Alte.
„Lassen Sie das,“ grollte Timotheus, „zeigen Sie uns das Haus! Es ist hoffentlich leer.“
„Nein,“ sagte die Alte, „da ich doch mit dem Agenten ausgemacht hatte, das Haus zu hüten, bis Sie kämen, habe ich ja zwar das meiste schon zu meiner Tochter nach der Stadt schaffen lassen; aber mein Bett musste ich mir doch hier behalten, einen Tisch und einen Stuhl und ein bisschen Kochzeug. Das brauche ich doch!“
„Das alles muss fort,“ rief Timotheus, „noch heute fort — zum mindesten das Bett; denn wir nächtigen nicht mit einer Frauensperson unter einem Dache.“
Das Weiblein schlug kichernd die Hände zusammen.
„O du meine Güte. Aber, Herr Weihrauch, ich bin dreiundsiebzig Jahre alt!“
„Das ist egal. Das Alter ändert am Geschlecht nichts. Mindestens das Bett muss noch heute raus!“
Das Storchenpaar, das natürlich vom Nestrande neugierig zugehört hatte, klapperte und schlug amüsiert mit den Flügeln.
„Faule Kunden!“ sagte der Storchenmann.
„Sehr faule!“ sagte das Weib. „Hat sich was mit Kindern! Die sind keine magere Kaulquappe wert, geschweige einen Frosch.“
Indes sagte das Weiblein unten im Garten:
„Ich zieh’ gerne fort. Seit dem Tode meines Seligen war es mir hier immer sehr einsam und wehmütig. Ich ziehe noch heute zur Tochter unten in der Stadt. Mein Schwiegersohn hat ein Speditionsgeschäft, der holt meine paar Sachen auf einem Rollwägelchen ab, noch heute.“
Da sagte Titus:
„Das trifft sich ja gut; da kann er doch unsere Sachen vom Bahnhof gleich abholen und uns heraufbringen.“
Die Alte sagte: „Ich weiss nicht, ob das heute möglich sein wird; der grosse Möbelwagen ist oft unterwegs.“
Titus erklärte ihr:
„Ein grosser Möbelwagen ist nicht nötig! Hören Sie, was Ihr Schwiegersohn abzuholen hat: Zwei kleine Tische, zwei Brettstühle, einen Küchentisch, einen Küchenstuhl, zwei Strohsäcke mit Strohkissen und einige Decken, einiges Küchenzeug, einige Bilder und Figuren, eine Kiste mit Wäsche, zwei Kisten mit Büchern und ein Harmonium.“
„Sonst nichts?“ fragte das Weib.
„Nein, sonst nichts!“
„Das andere kommt nach?“
„Nein, es wird nichts nachkommen, es ist alles, was wir haben und brauchen.“
„Auch nicht einmal Bettstellen und Kleiderschränke?“
„Nein, die sind unnötig!“
Das Weiblein wurde wieder von Angst ergriffen.
„Wenn die Herren erlauben, geh’ ich sogleich hinab nach der Stadt.“
„Ja, gehen Sie!“
Die Alte machte, dass sie fortkam.
Noch ehe die Sonne sank, war der Einzug beendet. Jeder der beiden Paulusjünger bewohnte ein Zimmer für sich. Am winzigen Fensterlein stand der kleine Tisch mit seinem Stuhl; auf dem breiten Fensterbrett lagen zwei Bücher: die Bibel und das Gesangbuch, bei Titus die lutherische, bei Timotheus die kalvinische Ausgabe. An der Hinterwand lag ein Strohsack mit einem Strohkissen an der Erde; an den bestbeleuchteten Stellen der Wand aber war in jeder der beiden armseligen Klausen ein Schmuckstück; auf kunstvollem Sockel in karrarischem Marmor der Torwaldsensche „Christus“, in jedem Zimmer auch zwei gute Kopien in Öl, bei Titus: „Pauli Bekehrung“, bei Timotheus: „Paulus predigt den Athenern von der Treppe der Akropolis“. In der Zelle des Titus hing ein Bild von Luther, in der des Timotheus eines von Calvin. Die Bücher, die an einer Wand am Fussboden lehnten, waren fast ausschliesslich religiöser Art und enthielten auch den schweren Zwiespalt zwischen Luther und Calvin. Gerade die Streitschriften der beiden Geisteskämpfer waren für Titus und Timotheus, die sich liebten, eine Quelle stetigen Grames und öfters auch des Streites; aber keiner wollte von seinem Standpunkt auch nur um eine Linie zurückweichen, namentlich nicht, was Abendmahls- und Prädestinationslehre betraf.
Es war Abend geworden. Die „Paulusjünger“ lehnten am Gartenzaune und sahen hinab nach der entzückenden Bergstadt, die in die weichen Arme von Wäldern und Gärten gebettet war, ringsum behütet von kraftvollen Bergen.
Allerhand Volk wanderte den Berg herauf, sah in den Garten und bestaunte die „Neulinge“.
„Wieviele Leute hier gehen,“ sagte Timotheus, „wir scheinen leider an eine Hauptstrasse der Stadt geraten zu sein.“
„Nein,“ sagte Titus, „sie kommen aus Neugierde. Unsere Ankunft ist unten wohl schon bekannt geworden durch die Alte, und nun strömen sie herbei, uns zu betrachten, wie sie ehedem zu dem hohlen Baume schlichen, in dem das gefangene Tierchen jammerte. Die Menschen sind so. Je nüchterner und alltäglicher sie sind, desto mehr sind sie aus nach Sensationen. Sie interessieren sich immer am meisten für das, was sie angeblich verachten.“
Читать дальше