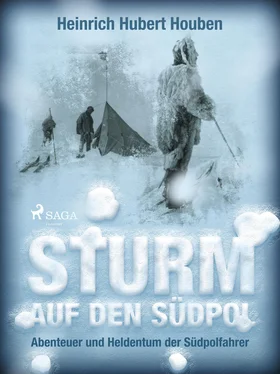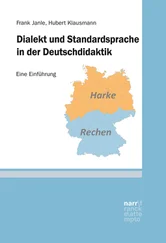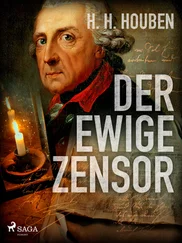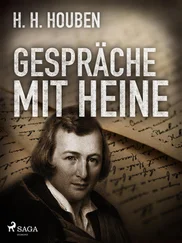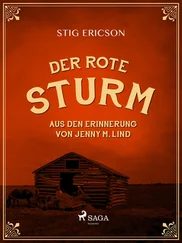Die beiden aus Kiefernholz gebauten Fahrzeuge sehen nicht gerade wie Eisbrecher aus, werden an ihren Unterwasserteilen noch schnell mit Kupferplatten verstärkt und lichten am 16. Juli die Anker, zunächst nach England, wo Bellingshausen die neusten Instrumente und Karten einkauft. Am 4. Dezember segeln sie von Rio de Janeiro nach Südgeorgien, das am 27. in Sicht kommt. Bellingshausen nimmt die von Cook nicht befahrene Südküste der Insel sorgfältig auf und findet vor ihrer Mitte ein kleines, hohes Felseneiland, das er nach dem Leutnant des „Mirny“ Annenkovinsel nennt. Auf der Weiterfahrt nach Osten entdeckt er drei andere kleine Inseln, die er dem russischen Marineminister zu Ehren Traversey-Inseln tauft; die eine von ihnen ist vulkanisch, dicke Schwefeldämpfe stossen aus dem Kraterberg empor; am 4. Januar 1820 landet ein Boot ohne Schwierigkeit an ihrem ganz schneefreien Strand; seine Bewohner, Unmassen Pinguine, sehen zum erstenmal Menschen und sind nur mit Stossen und Schlagen aus dem Weg zu bringen. Am 8. Januar erreicht Bellingshausen Cooks Sandwichland, das er mit grosser Genauigkeit kartographiert; es ist kein Festlandzipfel, sondern ein Archipel von neun Inseln.
Von da steuert Bellingshausen, rings von Treibeis und Eisbergen umgeben, nach Osten. Seine Aufgabe ist eine Umsegelung der Antarktis nach Cooks Vorbild. Das Experiment ist einmal gelungen, seine Wiederholung verliert daher den Reiz unerhörter Neuheit und Kühnheit. Der Nachfolger weiss schon, was er zu erwarten hat; er knüpft an die Ergebnisse des Vorgängers an; sein Ehrgeiz aber muss sein, sie zu verbessern. Bellingshausen soll die Meeresstriche untersuchen, wo noch niemand vor ihm war — niemand? In diesen Breiten ist das kein anderer als Cook, der mehrmals grosse Bogen nach Norden gemacht hat. Bellingshausen sucht daher möglichst überall südlicher durchzukommen als sein Vorgänger, und die Eisverhältnisse erlauben ihm das. Hat Cook nur 115 Längengrade innerhalb des 60. Breitengrads durchsegelt — der Russe übertrumpft ihn mit 243; 46 davon legt er sogar innerhalb des Polarkreises (66° 30′) zurück, was Cook nur bei 18 gelang. Bellingshausen dringt nicht nur drei-, sondern sechsmal über den Polarkreis vor und kommt gleich in den ersten Wochen seiner Fahrt am 2. Februar 1820 bis 69° 25′ und am 17. und 18. bis 69° 6′, beim drittenmal aber, am 26. Februar, nur bis 66° 53′ auf 40° 55′ ö. L., fast demselben Meridian, auf dem Cook am 17. Januar 1773 vor einer hohen Eismauer auf 67° 17′ s. Br. umkehren musste. Dadurch, dass Bellingshausen sich südlicher halten kann, kürzt er seinen Weg ab; den Gürtel, den Cook um die Antarktis legte, zieht er straffer an, damit schrumpft das schon so bescheiden gewordene, immer noch unsichtbare Südland abermals zusammen. Der russische Forscher übersommert nur einmal in Australien und der Südsee (vom 11. April bis 12. November 1820) und ist pünktlich in zwei Jahren wieder in Kronstadt, obgleich der „Mirny“ durch seinen grossen Tiefgang ein schlechter Segler ist. Seine höchste südliche Breite erreicht Bellingshausen im zweiten Abschnitt seiner Fahrt, am 22. Januar 1821 auf 92° 19′ w. L., wo er bis 69° 53′ vordringt; 14 Grad westlich davon betrachtete Cook am 30. Januar 1774 auf 71° 10′ s. Br. so nachdenklich die gebirgsartig aufsteigende Eislandschaft. So hohe Breite gewinnt Bellingshausen nirgends, dafür aber entdeckt er die ersten unzweifelhaften Landküsten innerhalb des Polarkreises, und dieser Erfolg sichert seiner Expedition ihre bleibende Bedeutung, mehr als die 27 Inseln, die er auf seiner 87 000 Kilometer langen Weltreise ausserhalb der antarktischen Zone fand; das mächtige Zarenreich legt auf so winzige und ferne Kolonien keinen Wert. Als er von seinem südlichsten Punkt, dem Treibeis ausweichend, nach Nordwesten segelt, zeigt sich am Horizont ein kleiner, schwarzer Fleck, und als die Sonne aus den Wolken tritt, steht da eine hohe Felseninsel, mit Ausnahme einiger schroffen Abhänge ganz mit Schnee bedeckt, aber von so undurchdringlichem Eis umgeben, dass die Schiffe nur bis auf 20 Kilometer herankönnen. Sie erhält den Namen Peters I., des Begründers der russischen Marine, und da Bellingshausen mehr Land in der Nähe vermutet, segelt er auf dem Breitengrad dieser Insel (68° 57′) noch ein Stück nach Osten. Seine Hoffnung geht über Erwarten in Erfüllung. Am Morgen des 29. Januar wird ein hohes Kap gesichtet, dessen gebirgiges Ufer sich nach Südwesten ausdehnt; hier und da brechen Felsen durch, im übrigen ist es ganz mit Schnee bedeckt. Ungeheure Eismassen verhindern auch hier jede Annäherung, und ob es Insel oder Festland ist, bleibt ungeklärt, da aber schneefreie Felsspitzen noch weit im Hintergrund erkennbar sind — es ist der hellste und schönste Tag, den die Expedition in südlichen Breiten erlebt —, gilt Alexanderland, wie sein Entdecker es benennt, fast ein Jahrhundert lang als der zuerst gesehene Ausläufer eines antarktischen Festlandes, dessen Existenz damit erwiesen ist. Seine weitere Erforschung wird nun das grosse Ziel der Südpolfahrer.
Bellingshausens Reise endet mit einer Überraschung. Er hat im Port Jackson (Sydney) erfahren, dass ein englischer Kapitän namens Smith im Jahre 1819 zwischen dem 62. und 63. Grad s. B. und nur 10 Längengrade von Alexanderland entfernt eine Kette unbekannter Inseln gefunden hat. Die will er sich etwas näher ansehen; sie könnten mit dem eben entdeckten Festland zusammenhängen; jedenfalls lässt ihre kartographische Bearbeitung noch einiges zu wünschen übrig; sein Weg führt ihn sowieso da vorbei, denn er will seine Fahrt bei Südgeorgien, wo er sie begonnen hat, abschliessen; das Flaggschiff „Wostok“ ist in einem so baufälligen Zustand, dass er froh sein kann, wenn er damit glücklich nach Hause kommt. Am 5. Februar sichtet er im Nordosten eine Gruppe von Inseln. Sind es die kürzlich von Kapitän Smith entdeckten oder andere, noch ganz unbekannte? Er fährt auf sie zu, in der Absicht, sie zu kartieren, da verschwindet das ganze Bild hinter einem plötzlich niederfallenden Nebel. Als nach einer Weile der Nebelvorhang ebenso plötzlich zerreisst, liegt ganz nahe bei den Russenschiffen ein fremdes Fahrzeug, so schmuck und sauber, als hätte es eben erst den Heimathafen verlassen! An seinem Mast geht sogleich die Flagge hoch, der Union-Jack; Bellingshausen antwortet mit der russischen Flagge und schickt ein Boot hinüber, den Kapitän des amerikanischen Einmasters um einen Besuch an Bord des „Wostok“ zu bitten. Kapitän Palmer, so heisst der Fremde, folgt der Einladung, und Bellingshausen erfährt zu seiner nicht eben freudigen Überraschung: das hier sind wirklich die Süd-Shetland-Inseln, aber an jeder dieser Inseln wimmelt es schon von Fangschiffen, gleich im nächsten Hafen, an der Deceptionsinsel, liegen ihrer acht aus England und Amerika, ihre Beute ist ungeheuer, einige haben schon eine Ladung von 60 000 Fellen. Palmer selbst kommt soeben mit seiner Schaluppe „Hero“ von einer Erkundungsfahrt geradeaus nach Süden zurück, er hat da unten ein neues gebirgiges, ganz mit Eis und Schnee bedecktes Land gesehen, zweifellos ein Stück des antarktischen Kontinents; vom Ankerplatz an der Deceptionsinsel aus könne Bellingshausen die Berglinien dieses Festlands mit blossen Augen erkennen; diese Küste sei übrigens noch viel unwirtlicher als die Inseln hier herum, eine Landung an ihrer hohen Eismauer sei selbst im Sommer unmöglich; Seeleoparden gebe es dort in Menge, aber leider keine Pelzrobben. Bellingshausen ist, ohne von dieser schnellen Entwicklung innerhalb des letzten Jahres etwas ahnen zu können, mitten in die neuesten Jagdgründe der internationalen Robbenschlächter hineingeraten.
Wal- und Robbenfänger entdecken
Kapitän Nathanael Palmer steht dem russischen Kommandanten mit grösster Bereitwilligkeit Rede und Antwort, er spielt mit Behagen den Fremdenführer, der diese ganze Gegend hier wie seine Westentasche kennt. Er hat ja auf dem „Wostok“ keine Konkurrenz vor sich, nur eine harmlose wissenschaftliche Expedition. Untereinander sind die Robbenfänger nicht immer so redselig. Wer einen reichen Fangplatz gefunden hat, schweigt sich darüber aus und macht erst reinen Tisch, bis die letzte Robbe vertilgt ist; für die Späterkommenden soll keine Flosse übrigbleiben; Schonung gibt es nicht, alles muss ans Messer, alt und jung, trächtige Weibchen und Mütter, deren eben geborene Junge umkommen mögen. Auf unbekannten Inseln gibt es keine Jagdgesetze — Eigennutz geht vor Gemeinnutz. Die amerikanische Konkurrenz treibt sich hier im Süden von Kap Hoorn schon lange herum. Manch einer will die Süd-Shetland-Inseln längst besucht haben, ehe sie von den Engländern entdeckt werden; seit 1812 soll dort schon eine amerikanische Fangstation gewesen sein. Die Sage von der Fahrt des Holländers Dirk Gerritsz bis zum 64. Breitengrad und von dem dort gesehenen Land ist immer noch lebendig; wer keine rechte Beute machte, sah sich gern einmal weiter im Süden um, hütete sich aber wohl, jede neue Robbenküste an die grosse Glocke zu hängen. Mit dieser geschäftlichen Geheimniskrämerei ist es 1819 aus.
Читать дальше