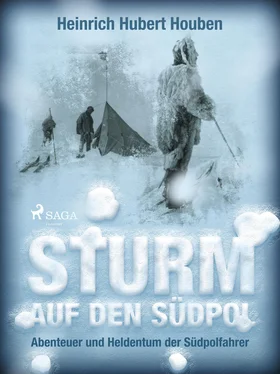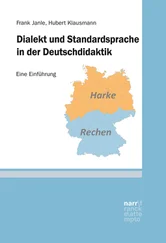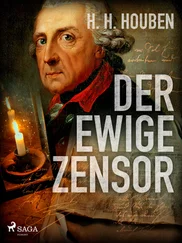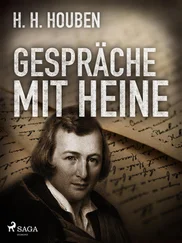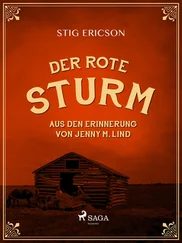Der Winter 1772/73 (Sommerszeit in der Antarktis!) ist der Schiffahrt ebenso ungünstig. Drei Jahre vorher hat Cook unterhalb Kap Hoorn bis zum 60. Grad Prachtwetter getroffen, jetzt überraschen ihn südlich vom Kap der Guten Hoffnung schon auf dem 42. Grad Stürme, die seine „Resolution“ am 29. November in grösste Gefahr bringen. Ein Unteroffizier erwacht mitten in der Nacht von einem plätschernden Geräusch, springt auf und steht bis über die Waden im Wasser. Er schlägt sofort Lärm, in wenig Minuten ist die ganze Besatzung auf den Beinen, alles stürzt an die Pumpen und arbeitet verzweifelt; aber das Wasser steigt immerfort, Rettung unmöglich —die Boote werden schon klar gemacht. Da ergibt sich, dass in einer Vorratskammer eine Luke nicht fest geschlossen war, die Wellen haben sie aufgeschlagen und dringen hier so gewaltig ein, dass das Schiff unfehlbar in kurzem gesunken wäre. Nun ist dem Unglück schnell vorgebeugt, aber Kleider, Betten und Gepäck der Mannschaft wie der Offiziere sind vom Seewasser völlig durchnässt, die Schiffsräume noch lange ein sehr übler und ungesunder Aufenthalt, zumal da der Sturm, von Schneefällen und Regen begleitet, gar kein Ende nehmen will. Am 8. Dezember zeigen sich als Vorboten des Treibeises die ersten Pinguine, diese der Antarktis eigenen amphibienartigen Vögel, die ihre verstümmelten Flügel, zum Fliegen untauglich, als Ruder verwenden und durch ihre Schwimm- und Tauchkunst höchstes Erstaunen erwecken; von ihrem starken, schwarzweissen, fettigglatten Federkleid prallen Schrotkörner wirkungslos ab; die Naturforscher müssen schon eine Kugel daranwendm, wenn sie dieser Beute habhaft werden wollen. Am 10. Dezember kommt auf 50° 4′ s. B. schon der erste Eisberg angeschwommen, etwa 650 Meter lang und 70 Meter hoch, nur ein schmales Modell der tafelförmigen Riesen, die jeden Sommer von den Inlandgletschern der Antarktis in ungeheurer Zahl abbrechen und, Tiefseeströmungen folgend, nach Norden ziehen; ihre Entstehung ist den ersten Südpolforschern noch unerklärlich; wohl aber weiss man, dass solch ein schwimmender Berg einen sechs- bis siebenmal grösseren Tiefgang unter Wasser hat, jedes Schiff also ihm gegenüber eine lächerliche Nussschale ist. Von Tag zu Tag werden nun diese unheimlichen Eisberge zahlreicher und zudringlicher; an ihren hellblau und grün schimmernden Steilhängen tobt die Brandung so heftig, dass der Wellenschaum bis zu ihren Gipfeln emporspritzt, Wolken von weissen, blauen und grauen Sturmvögeln, Raubmöwen, Seeschwalben und Albatrossen, deren Eiement der Sturm ist, umschwärmen sie, und ihre Annäherung drückt auch bei Sonnenschein die Quecksilbersäule des Thermometers gleich um 2 Grad Celsius herab, eine zuverlässige Wamung besonders bei unsichtigem Wetter. Nebel ist im Eismeer überall des Seemanns schlimmster Feind, er ist unberechenbar und stürzt unversehens wie eine Lawine hernieder. Die Gelehrten der „Resolution“ wissen davon zu erzählen. Eine Windstille am 14. Dezember wird von ihnen schnell zu Messungen der Meeresströmungen und -temperaturen benutzt, der Naturforscher Forster und Astronom Wales sind in einem kleinen Boot nahe dem Schiff eifrig damit beschäftigt, als sie plötzlich in einer weissen Wolke stehen, dicker Nebel hat in wenig Augenblicken beide Schiffe wie verschluckt. Sie rufen — keine Antwort kommt; sie rudern unruhig hin und her, schreien, so laut sie können — alles bleibt totenstill. Was sollen sie tun? Sie haben weder Mast noch Segel noch die geringsten Lebensmittel, nur ihre zwei Ruder. Das beste wird sein, da zu bleiben, wo sie sind; so lange die Windstille anhält, werden die Schiffe hoffentlich nicht abtreiben. Die zwei Männer horchen gespannt auf jeden Laut. Nach endlos langer Zeit läutet wie aus grosser Entfernung eine Schiffsglocke; sie rudern in Schallrichtung, rufen immer wieder, erhalten endlich Antwort und sehen den schwarzen Bug eines Schiffes — es ist die „Adventure“, deren Befehlshaber Kapitän Tobias Fourneaux auch nicht ahnt, wo das Flaggschiff steckt. Ein Kanonenschuss fragt in die Weite — die Antwort kommt aus solcher Nähe, dass man sich von Bord zu Bord mündlich verständigen kann. Darauf kehren die Gelehrten zur „Resolution“ zurück; nach den verlebten Schreckensstunden kommen ihnen ihre höhlenartigen Kabinen und feuchten Betten als Gipfel der Behaglichkeit vor.
Cook steuert auf dem 22. bis 23. Längengrad südwärts. Nach Osten wird eifrig Ausschau gehalten, dort müsste irgendwo Kap Bouvet aufragen. Offiziere und Mannschaft wollen alle Augenblicke mit Bestimmtheit Land sehen; beim Näherkommen sind es Wolken, Nebelbänke, höckerige Eisinseln und hohe Eisberge, an deren Fuss Pinguine spielen und zahlreiche Walfische ihre Fontänen in die Luft blasen. Wenn Kap Bouvet Vorgebirge ist, müsste hier herum die Küste seines Hinterlandes sich nach Südwesten hinziehen; statt dessen legt sich am 14. Dezember auf 54° 55′ s. Br. undurchdringliches Packeis in den Weg. Cook segelt an dessen Rand vorsichtig nach Osten, wagt es hin und wieder, schmale Ausläufer des Packeises zu durchschneiden und bohrt sich, wo immer eine Lücke klafft, nach Süden und Südosten durch, meist im Nebel sich vortastend, von Schneefällen, Regen und Hagelschauern begleitet. Bei der Mannschaft zeigen sich, trotz des täglich verabreichten Sauerkrauts, Anzeichen von Skorbut, aber reichlicher Genuss von Bierwürze erweist sich als sicheres Heilmittel. Die erste Reise in die Antarktis muss in jeder Hinsicht eine Studienfahrt sein; man lernt den „Eisblink“, den Widerschein grosser Eisfelder am Horizont, von dem dunklern Wasserhimmel unterscheiden und aus Meereis Trinkwasser gewinnen, denn gefrierendes Seewasser scheidet seinen Salzgehalt aus; aber blosses Eiswasser lässt die Halsdrüsen anschwellen, daher der häufige Kropf der Gebirgsbewohner; immerhin beseitigt es die schwerste Gefahr damaliger Seereisen, Mangel an Trinkwasser, und die Schildwache neben der Wassertonne auf Deck braucht es nicht gar so streng mehr zu nehmen. Zum Waschen aber benutzen Kapitän und Mannschaft ausnahmslos Seewasser.
Auf dem 33. Längengrad treibt heftiger Oststurm die Schiffe bis 9° 45′ nach Westen zurück, aber da das Packeis nach Norden abschwimmt, gewinnt Cook Raum nach Süden. Hier wenigstens, fast südlich von Kap Bouvet, müsste doch nun endlich die Küste seines Hinterlandes erscheinen, aber nichts zeigt sich. Sobald der Wind sich dreht, geht die Fahrt nach Osten und Südosten weiter, und der 17. Januar 1773 wird der erste denkwürdige Tag in der Geschichte der Südpolforschung: Cook überschreitet den südlichen Polarkreis (66½°), bricht sich an dreissig grossen Eisfeldern entlang Bahn durch das Packeis bis 67° 17′. Hier aber, auf 39° 35′ ö. L., kündigt der Eisblink ein unabsehbares, festes und ebenes Eisfeld an; sein Nordrand ist eine 5 bis 6 Meter hohe Eismauer, an deren Fuss sich ein dicker, kaum von der Dünung bewegter Brei von löcherigem, zermürbtem, auffallend schmutzigem Brucheis entlangzieht. Cook steht hier zum erstenmal vor der Kante eines jener unermesslichen Eisgletscher, die sich vom antarktischen Inland langsam nach Norden vorschieben und Eisberge „kalben“, auf dem Wasser schwimmen, aber irgendwo auf festem Land aufliegen. Er weiss sich diese befremdende Erscheinung noch nicht zu deuten, und da er hier weder im Süden noch im Osten durchkommt (hinter den Eismassen im Osten verbirgt sich das 58 Jahre später entdeckte Enderby-Land), begibt er sich nordostwärts auf die Suche nach Kerguelen-Land, der neuesten Entdeckung der Franzosen, von der er in Kapstadt gerade noch vor seiner Abfahrt gehört hat. Da Näheres über seine Lage usw. nicht bekanntgemacht wurde, findet er die Küste nicht, wo er sie sucht, aber er kreuzt hin und her und fährt schliesslich südlich der vom Entdecker angegebenen Breite nach Südosten durch, also kann es sich auch da nur um eine Inselgruppe handeln, die keinerlei Verbindung mit einem südlichen Kontinent hat.
Читать дальше