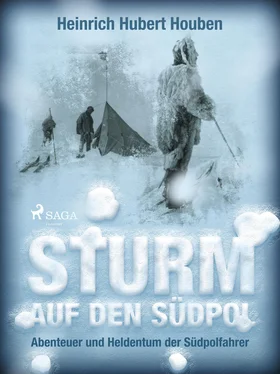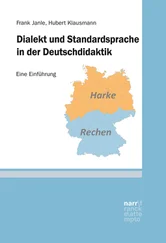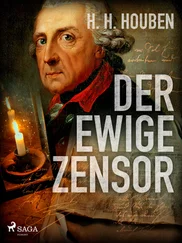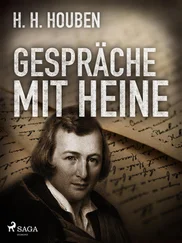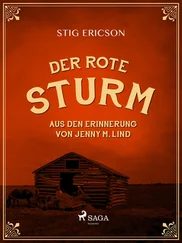Auf eine nähere Untersuchung dieser Küste verzichtet er, denn die Tage werden kürzer, die Lebensmittel sind schon bedrohlich gering, die Sauerkrautfässer leer, von Würmern zerfressener Zwieback und halbverwestes Pökelfleisch die einzige Nahrung. Er hält Sandwichland für einen Inselarchipel, womit er Recht hat, aber selbst, wenn es der einzige, den 60. Breitengrad überschreitende Ausläufer eines polaren Festlandes wäre, sähe er sich nicht weiter danach um. Er ist ausgezogen, um festzustellen, ob in den ungeheuren Meeren der südlichen Halbkugel ein grosses, bewohn- und kolonisierbares Festland verborgen ruht, und es für England in Besitz zu nehmen. Eis- und Schneegebirge, schauderhafte Klippenküsten wie dieses Sandwichland, an dem man Fels, Erde und Eis kaum voneinander unterscheiden kann, lohnen keine weitere Mühe. Er ist durchaus überzeugt, dass der Südpol einen Landkern hat, von dem sich die Eismassen ablösen, die den Ozean im Süden überall unsicher machen, und aus der Erfahrung, dass sie sich im Atlantischen und Indischen Ozean viel weiter nördlich herumtreiben als anderswo, zieht er den zutreffenden Schluss, dass sich nach diesen beiden Seiten hin beträchtliche Stücke des Polarlandes entsprechend weiter nach Norden vorschieben, Sandwichland also wohl ein Ausläufer davon sein könnte. „Aber“, so erklärt er, „es wäre verrückt gewesen, alles, was wir auf der Reise erzielt hatten, aufs Spiel zu setzen, nur um eine Küste zu entdecken und zu erforschen, die, einmal entdeckt und erforscht, zu nichts dient und deren Kenntnis weder der Schiffahrt noch der Geographie noch sonst einer Wissenschaft förderlich sein kann.“
Um aber den vorgeschriebenen Kreis gewissenhaft zu schliessen, fährt er von Sandwichland ostwärts bis zu dem Punkt, wo er, zu Beginn der Reise von Norden kommend, nach Osten abwich, er segelt dabei über die Stelle hinweg, wo Kap Bouvet liegen soll, und ankert am 22. März 1775 wieder in der Tafelbucht bei Kapstadt, von wo er ausgegangen. Trotz der übermenschlichen Strapazen und Entbehrungen während der fast dreijährigen Reise hat er nur einen Matrosen durch Krankheit verloren, ein Erfolg des Sauerkrauts und der Bierwürze, der den Seefahrern jener Zeit als das grösste aller Wunder erscheint.
Cooks Weltreise um die Antarktis ist mit der Tat des Kolumbus verglichen worden und steht ihr an Kühnheit und Verdienst wenig nach, obgleich sie, in ihrem antarktischen Teil, keine neue Welt hervorzaubert, sondern im Sinne jenes Zeitalters der „Aufklärung“ die Phantasie entthront und die nüchterne Wirklichkeit an ihre Stelle setzt. Die Lieblingsvorstellung der alten Kosmographen, das märchenhafte Südland, hat jetzt abgewirtschaftet, der angebliche Riesenkontinent, der im Stillen Ozean fast den Äquator berühren sollte, schrumpft zu einem gottverlassenen Eisland zusammen, das durch den 60. Breitengrad begrenzt ist, sich aber an mehreren Punkten bis hinter den Polarkreis zurückzieht. Das Bild der südlichen Halbkugel der Erde ist damit in der Tat aufgeklärt, es zeigt unvergleichlich mehr Wasser als Land, und die mathematischen Mümmelgreise müssen nun sehen, wie sie das notwendige Gleichgewicht des Erdballs wieder in Ordnung rechnen.
James Cook hat auf seiner Weltreise um die Antarktis Südgeorgien, das Paradies der See-Elefanten und Pelzrobben, für England in Besitz genommen, obgleich kein Zweifel besteht, dass ein Spanier Antonio de la Roché mit zwei Kauffahrteischiffen, die aus Hamburg stammten, aber nicht unter dessen Flagge fuhren, diese Insel 1675 entdeckte und ein spanisches Handelsschiff „Leon“ sie 1756 wiederfand. Was soll Cooks reiches Vaterland, dem die sonnige Südsee so viel Herrlichkeiten beschert, mit einer Insel, die mehr einem jener Eisbergriesen aus dem Innern der Antarktis ähnelt als einem Festland? Niemand kann ja geringschätziger darüber urteilen als Cook selbst! „Südgeorgien“, erklärt er, „widerlegt die landläufige Meinung, dass jeder Teil der Erde, der wildeste und kälteste nicht ausgenommen, Menschen zum Aufenthalt dienen könne. Schon der Sommer ist hier sehr kalt, der Winter aber würde ein menschliches Wesen unfehlbar töten. Den Handel kann nichts verlocken, sich bis zu diesen Breiten vorzuwagen. Der blaugraue Schiefer von Südgeorgien enthält keine Metalle, und See-Elefanten und See-Löwen, deren Tran einen Handelsartikel bildet, findet man an den südlichen Küsten Amerikas viel häufiger. Sollte der Walfischfang am Nordpol dereinst abnehmen, dann brauchte man auch diese Tiere nicht bei Südgeorgien zu suchen.“ Wie sehr überschätzt Cook den Reichtum der Welt! Auffallender noch: wie sehr unterschätzt dieser grosse Entdecker die Tatkraft und Zähigkeit der menschlichen Rasse und ihrer Haupttriebfedern Habsucht und Not! Und wie drastisch hat ihn die Geschichte widerlegt! Sofort nach Bekanntwerden des Cookschen Berichtes werden in England und Amerika Jagdschiffe ausgerüstet, um See-Elefanten und Pelzrobben zu jagen. Die Ausbeuter wirtschaften so gründlich, dass um 1820 die Küsten Südgeorgiens schon als verödet gelten. Die Pelzrobben kommen nicht mehr recht auf, nur die See-Elefanten erholen sich. Später wird Südgeorgien ein Mittelpunkt des Walfanges, den der um die Südpolforschung verdiente Kapitän Carl Anton Larsen organisiert. Auf den Tussokgraswiesen einiger seiner Täler äsen Renntiere, die Larsen 1908 aus seiner norwegischen Heimat mit Erfolg dort eingeführt hat. 1919 zählt Südgeorgien schon 1000 Einwohner, und heute ist die Fangschifferstation Grytviken an der Kochtopfbucht eine kleine Stadt mit behaglichen Klubräumen und einem Kino in der Kirche, die derselbe Larsen hat erbauen lassen. Die Kälte tötet die Menschen nicht mehr, wie Cook seine Zeitgenossen glauben machen möchte. Oder will er mit seiner Warnung nur dem zu befürchtenden Schicksal der Insel vorbeugen oder wenigstens fremde Nationen abschrecken, solange England selbst mit Amerika, Australien und der Südsee kolonial überbeschäftigt ist?
Auch seine eindringliche Warnung vor dem Polarlande, an dessen Existenz er doch glaubt, klingt ein wenig verdächtig! Er schildert es in den schwärzesten Farben: „Man muss den dichten Nebeln, den Schneestürmen, der durchdringenden Kälte und all den Gefahren trotzen, die nur irgend die Schiffahrt bedrohen können. Die Küsten, deren Aussehen weit schrecklicher ist, als sich jemand vorstellen kann, erhöhen diese Gefahren noch. Dieses Land ist von der Natur dazu verdammt, nie die Wärme eines Sonnenstrahls zu fühlen und für ewig unter Schnee und Eis verborgen zu bleiben. Die Häfen, die man da finden mag, sind sämtlich mit Eis von bedeutender Dicke angefüllt, und sollte einer so weit offen sein, um ein Schiff hereinzulassen, so würde es dort für ewig festgehalten werden oder nur in eine Eisinsel eingefroren wieder herauskommen. So sind schon die Länder, die wir entdeckt haben (Südgeorgien und Sandwichland); wie mögen dann wohl erst jene sein, die noch weiter gegen Süden liegen? Man muss ja vernünftigerweise annehmen, dass wir noch die besten, weil nördlichsten, gesehen haben. Sollte aber jemand den festen Willen und die Ausdauer haben, diesen Punkt durch ein weiteres Vordringen aufzuklären, so werde ich ihn um den Ruhm dieser Entdeckung nicht beneiden, aber ich bin so kühn, zu erklären, dass die Welt keinen Nutzen davon haben wird.“ Und dann entschlüpft ihm das viel zitierte, stolze Wort: „Die Gefahr eines weiteren Vordringens an dieser Küste ist so gross, dass ich dreist behaupte: kein Mensch wird sich jemals weiter vorwagen, als ich es tat, und die Länder um den Südpol werden für immer unentdeckt und unerforscht bleiben!“
Cook hat durch seine Umseglung der Antarktis gleichsam eine Schlinge um dieses Land gelegt — will er die übrige Welt veranlassen, diesen Zauberkreis zu respektieren und England hier nie in die Quere zu kommen, bis es selbst Zeit gewinnt, an die Aufhellung dieses Teils der Erdoberfläche zu gehen? Der Erfolg seiner abschreckenden Warnung ist jedenfalls unbestreitbar. Die Wal- und Robbenjäger halten sich an die Inseln, die ausserhalb des südlichen Polarkreises schon bekannt sind oder auf ihren Beutezügen neu gefunden werden. Eine Entdeckungsexpedition aber lässt sich länger als vier Jahrzehnte nicht mehr jenseits des 60. Breitengrades sehen. Erst 1819 kommt der Zar Alexander I. von Russland auf den Gedanken, die vielen Unternehmungen, durch die er dem russischen Handel Weltgeltung zu verschaffen weiss, durch zwei wissenschaftliche Expeditionen zu krönen: die eine soll das nördliche, die andere das südliche Polarmeer aufsuchen. Am 25. März 1819 befiehlt er die Ausrüstung der nötigen Schiffe und ernennt zwei Monate später zum Führer der Südexpedition den Kapitän Fabian Gottlieb von Bellingshausen, der schon die erste russische Weltumseglung unter Krusenstern 1803—1806 mitgemacht hat. Als dieser vom Schwarzen Meer, wo er eine Korvette befehligt, in Kronstadt eintrifft, warten auf ihn im dortigen Hafen zwei bereits völlig segelfertige Schiffe: „Wostok“ (der Osten), eine mit 20 Kanonen bestückte Korvette von 70 Meter Länge mit 117, und das 530 Tonnen fassende Transportschiff „Mirny“ (der Friedfertige) mit 72 Mann Besatzung. An Bord des „Wostok“ sind der Astronom Iwan Simanow und der Maler Pawel Michailow; zwei deutschen Naturforschern, Mertens in Halle und Gustav Kunze in Leipzig, die mitreisen sollen, lässt man nicht Zeit, sich angemessen auszurüsten, sie lehnen daher ab; Ersatz ist in der Eile nicht zu beschaffen, also muss es ohne Naturforscher gehen. Befehlshaber des „Mirny“ ist Leutnant Michail Lazarew, der ebenfalls schon einmal die Welt umsegelte auf einem Schiff der russisch-amerikanischen Handelskompagnie; vorher war er vier Jahre in englischen Diensten.
Читать дальше