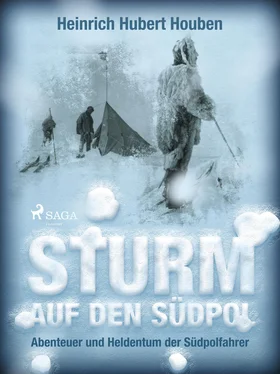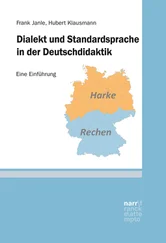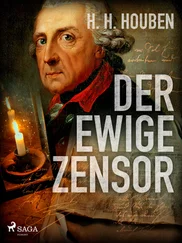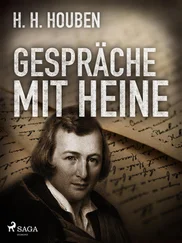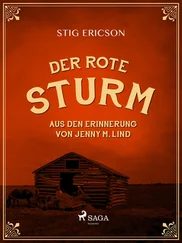1 ...6 7 8 10 11 12 ...26 Man sollte meinen, die Geographen Europas machen einen Luftsprung, als sie 1825 Weddells schmucklosen und gerade dadurch überzeugenden Reisebericht lesen, aber da regt sich nichts. England hat mit Australien, der Südsee und Kanada alle Hände voll zu tun, und seine grossen Polarforscher John und James Ross, Parry, Franklin usw. nehmen ausschliesslich den arktischen Teil Nordamerikas mit Wucht in Angriff. Die Antarktis, so weit entfernt, bleibt einstweilen den Wal- und Robbenfängern preisgegeben, die ja bewiesen haben, dass sie recht tüchtige Roharbeit leisten und der systematischen Forschung manchen Stein aus dem Wege räumen; ihre etwas wirren und groben Kartenskizzen wird früher oder später die Wissenschaft schon ins reine zeichnen. Mit den Aufklärungsarbeiten soll man teure Expeditionen nicht belasten; für sie ist die Gewinnsucht der beste Vorspann, und wenn sich noch mehr so tapfere Draufgänger finden wie Weddell, übersieht die englische Admiralität besser, wo sie später erfolgversprechend anzusetzen hat. Da ist in London die grosse Reederei Charles Enderby, die sucht stets solche Leute, die für Wal- und Robbenfang neue Gebiete erschliessen; sie schärft ihren Kapitänen ein, sich keine Gelegenheit zu Landentdeckungen entgehen zu lassen, versieht sie mit den dazu nötigen nautischen Instrumenten und rechnet nicht kleinlich nach, wenn auf solchen mehr Entdeckungs- als Beutezügen die Ladung an Fellen und Tran einmal spärlich ausfällt und kaum die Unkosten deckt. Doch solche Leute, die geschäftliche Umsicht mit wissenschaftlicher Vorbildung und persönlichem Mut vereinen, sind selten. Einmal aber tut Enderby einen besonders glücklichen Griff. Am 14. Juli 1830 verlassen zwei kleine Schiffe den Hafen von London, die Brigg „Tula“ von 148 und der Kutter „Lively“ von 70 Tonnen; Führer der Expedition ist Kapitän John Biscoe, den Kutter befehligt Kapitän Smith, der Entdecker der Süd-Shetland-Inseln, deren Küsten längst so ausgeplündert sind, dass es sich kaum mehr lohnt, dahinunter zu gehen. Den beiden erfahrenen Kapitänen wird es hoffentlich gelingen, irgendwo in den antarktischen Meeren neue Fangplätze auszukundschaften. Die Schiffe segeln zunächst nach den Falkland-Inseln und von da nach Osten. Seit 1762 haben spanische Schiffe dortherum dreimal Land gesichtet, die Aurora-Inseln; auch Weddell hat ihnen schon nachgespürt, aber vergeblich, und Biscoe geht es ebenso. Er steuert deshalb auf die Sandwich-Inseln zu, in deren Süden ihn aber das Eis nicht durchlässt. Er fährt nördlich um sie herum und dann nach Südosten, passiert am 21. Januar 1831 in fast eisfreiem Wasser den Polarkreis und erreicht am 1. Februar seine höchste südliche Breite, 69° 25′ auf 13° ö. L.; etwas weiter östlich hat Bellingshausen elf Jahre vorher seinen ersten Vorstoss nach Süden gemacht und ist auch nicht weiter gekommen. Zahlreiche Vögel und die Farbe des Wassers deuten auf nahes Land; in den folgenden Tagen wiederholen sich diese Anzeichen, aber Biscoe muss am 4. Februar dem schweren Packeis ausweichen und bis an den Polarkreis zurückgehen. Die beiden kleinen Schiffe leisten Wunderbares, denn auf dieser ganzen Strecke treiben Ostwind und Strömung ihnen die Eismassen stets entgegen. Am 19. Februar erreichen sie genau die Stelle, wo im Januar 1773 eine Eismauer Cook Halt gebot und Bellingshausen noch früher nach Norden zurückgehen musste. Biscoe aber glückt es, sich von hier an einige Tage nahe dem Polarkreis zu halten, und er sieht nun, wie die Eismauer nach Osten hin langsam höher wird, 30, 35 Meter und mehr. Sie ist die Steilküste eines Landes, das am 25. Februar in 66° 2′ s. B. und 43° 54′ ö. L. sichtbar wird und am 27. (in 65° 57′ s. B. und 47° 26′ ö. L.) zu gewaltigen Bergrücken aufsteigt, deren schwarzfelsige Gipfel aus dem weissen Schnee gespenstisch hervorragen. Bei den Versuchen, durch den 40 bis 60 Kilometer breiten Eisgürtel, der das Land umgibt, bis zu seiner Küste vorzudringen, überrascht die beiden Schiffe ein schwerer Sturm; die „Tula“ wird 240 Kilometer nach Westen zurückgetrieben. Dennoch gelingt es Biscoe, noch einmal in Sicht des Landes zu kommen, zahlreiche Skorbutfälle an Bord aber zwingen ihn, schleunigst nach Norden zu gehen. Als er in Hobart auf Tasmanien am 7. Mai ankommt, sind zwei Matrosen gestorben und die übrigen so krank, dass die „Tula“ nur von ihren drei Offizieren, einem Matrosen und einem Schiffsjungen in den Hafen gesteuert wird. Dennoch hat sich Biscoe noch bis zum 81. Längengrad innerhalb des 60. Breitengrades behauptet. Den Kutter hat Kapitän Smith nach Port Phillip an der Südküste Australiens retten können; im August trifft auch er in Hobart ein.
Am 10. Oktober gehen beide wieder unter Segel, zunächst auf Robbenfang nach Neuseeland und westlich davon an den Chatham- und Bounty-Inseln, aber was sie dort erwischen, lohnt kaum den Aufenthalt, und an neuen Fangplätzen haben sie noch nicht einen gefunden. Vielleicht winkt ihnen auf der andern Seite der Antarktis mehr Glück. Also steuern sie am 4. Januar 1832 nach Südosten, und aus der geschäftlichen Erkundungsfahrt wird die dritte Weltumsegelung im antarktischen Südmeer, nur dass Biscoe vom Glück weit stärker begünstigt ist als seine beiden Vorgänger Cook und Bellingshausen. Er hat die erste unzweifelhafte Landküste am Südpol gefunden, nach seinem Auftraggeber nennt er sie Enderby-Land, und der zweite Teil der Fahrt beschert ihm eine noch viel wichtigere Entdeckung. Am 14. Februar ist er schon auf dem Meridian von Feuerland, und am 15. segelt er auf eine hohe Insel zu, der er den Namen der Königin Adelaide von England gibt. Daran schliesst sich eine ganze Kette weiterer Inseln, die seitdem als Biscoe-Inseln auf den Karten der Antarktis stehen. Im Hintergrund dieser von Eis blockierten Inseln aber zeichnen sich die gewaltigen Umrisse eines hohen Festlandes ab, das sich weiter östlich nach Norden in den Ozean vorschiebt, wie Biscoe wenigstens glaubt; denn das Eis lässt ihn nicht so nahe heran, dass er festzustellen vermag, ob diese ungeheuren Landmassen ein zusammenhängendes Ganzes bilden oder sich in einen Archipel grosser Inseln auflösen, was sich erst zweiundvierzig Jahre später offenbart. An der Westecke dieser vermeintlichen Festlandküste findet Biscoe eine grosse Bucht, die von zwei hohen Bergen überragt wird, dem Mount William und dem Mount Mowerby; die Lage des ersteren stellt er mit 64° 45′ s. B. und 63° 51′ w. L. richtig fest. Er landet am Strande dieser Bucht und betritt als erster eine Küste in diesen Breiten. Dem ganzen Landkomplex gibt er den Namen des damaligen Chefs der englischen Admiralität, und Graham-Land spielt von nun an in der Geschichte der antarktischen Forschung eine Hauptrolle. — Von da segelt Biscoe nach den Süd-Shetland-Inseln, wo der Sturm die „Tula“ auf die Küste wirft; ihr Steuer zerbricht, dennoch gelingt es dem Kapitän, wieder flott zu werden und die Falkland-Inseln zu erreichen. Dort scheitert der Kutter „Lively“, die Mannschaft aber wird gerettet.
Die ausserordentlichen Erfolge Biscoes, dem an einwandfreien Entdeckungen mehr gelungen ist als allen bisherigen Forschern in der Antarktis zusammen, erregen mit Recht grosses Aufsehen, und die Geographischen Gesellschaften von London und Paris erkennen ihm ihre grosse goldene Medaille zu. Auch das Haus Enderby ist stolz auf diesen Kapitän und rüstet gleich zwei neue Schiffe aus, mit denen er seine Entdeckungsreise fortsetzen soll; ein Vertreter der Admiralität, Leutnant Rea, wird als Teilnehmer an der neuen Expedition abkommandiert. Daraus ergeben sich anscheinend Streitigkeiten über die Führung des Oberbefehls, Biscoe ist offenbar nicht geneigt, seine Selbständigkeit aufzugeben, und tritt zurück. Irgendein Neuling übernimmt sein Amt und fährt so tollkühn drauflos, dass schon auf der ersten Etappe das Schicksal dieser zweiten Expedition besiegelt ist. Eines der beiden Schiffe wird bei den Süd-Shetland-Inseln vom Eis zermalmt, das andere entgeht nur mit knapper Not dem Verderben.
Читать дальше