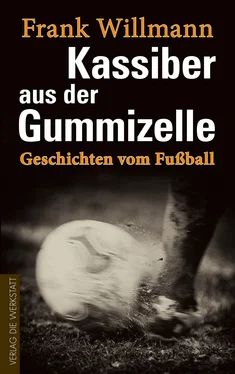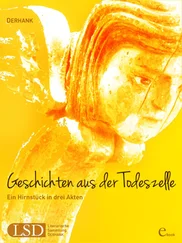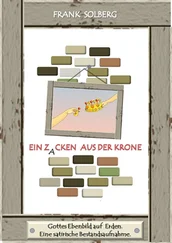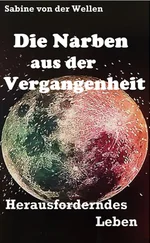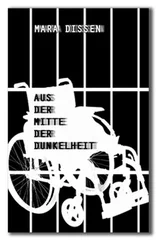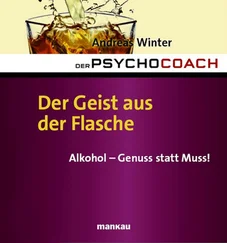Die neunziger Jahre waren hoolgeprägt, Zuschauerzahlen gingen zurück. Ab 2001 kam wieder Stimmung im Stadion auf. Die Ultramode schwappte nach Dresden. Große Choreos, positive Stimmung, Dynamo war plötzlich für jüngere Leute wieder chic. Ultras Dynamo hat die Dresdner Massenbewegung neu entfacht, mit Dynamoschal rumzuwatscheln, bissel böse gucken, war wieder geil. Es folgten fünf bis sechs Jahre Fasching, Pyro, Rauch. Am Anfang wurden die Dresdner Ultras von der anderen starken Außenseiterfraktion, den Hools, kritisch beäugt. Auch zurechtgestampft, linke Folklore raus!
Mitte der Nuller tauchte FDO auf. Faust des Ostens. Kleinkriminelle mit Nazitouch. Sie verschwanden inklusive Banner wie durch ein Wunder vor einiger Zeit wieder aus dem Stadion.
Dann gibt es noch die Wald-und-Wiesen-Fraktion. Hooligans Elbflorenz. 2014 laufen noch immer Prozesse gegen HE. Einige ihrer Mitglieder haben heftige Naziverstrickungen, doch HE ist keine rechte Vereinigung. Eher ein loser Zusammenschluss von Hochleistungskampfsportlern, darunter auch Leute mit Migrationshintergrund, Kämpfer, Boxer aus dem Nichtrechten- und Nichtfußballspektrum.
Im März 2013 verurteilte das Dresdner Landgericht vier Mitglieder der Hooligans Elbflorenz wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung sowie teilweisen Landfriedensbruchs zu Haftstrafen zwischen neun Monaten und vier Jahren. 2008 hatten die vier neben fünfzig weiteren Vermummten drei Dönerläden anlässlich des EM-Halbfinalspiels zwischen Deutschland und der Türkei überfallen. Es hält sich bis heute hartnäckig die Geschichte, bei den Überfällen sei es nicht um Ausländerhass, sondern um Revierkämpfe unter Kriminellen gegangen. Drogen, Nutten. Wer hat die Macht in der Stadt?
Hooligans Elbflorenz und Faust des Ostens sind inzwischen offiziell aus dem Stadion verschwunden, ihre Exmitglieder nicht.
2009 wird das runderneuerte Rudolf-Harbig-Stadion eröffnet. Es bringt Dynamo neue Fans, der K-Block wird Heimstatt der Ultras, Kutten und Anverwandten. Trainer, Aufsichtsrat, Spieler und Funktionäre wechseln immer noch wie die Fliegen.
Heute sehen viele Dresdner die finanzielle Unterstützung Dynamos durch die Stadt kritisch. Auch die hohe Fluktuation in der Geschäftsführung und die fehlende Kontinuität im Verein werden bemängelt. Die Vereinsführung feuert Anfang 2014 den Geschäftsführer Christian Müller. Den Einzigen, der bei Dynamo Lobbyarbeit betrieb.
Obgleich in der DDR der Antifaschismus Staatsdoktrin war, spukte in den Köpfen der Bürger noch die Ideologie des Naziregimes. Wenn irgendwo etwas faul war oder bestimmte Teile der Bevölkerung scheinbar bevorteilt wurden, klickte der Schalter von links nach rechts. Die Juden waren wieder schuld. Egal ob in Dresden, Jena oder Magdeburg. Wie konnte man als Fußballfan im Schutz der anonymen Masse den DDR-Staat auch heftiger ärgern? Nazi zu sein, war die extremste aller Provokationen und gerade unter jugendlichen Fußballfans, die bis tief in die Neunziger hinein mehrheitlich aus dem Arbeitermilieu stammten, en vogue. Der DDR-Staat schwieg das Problem tot, in der Öffentlichkeit wurde es nicht thematisiert.
Aufklärung ist ein langer Prozess. Es gibt in der Dresdner Fanszene einige progressive Gruppierungen. Eine davon ist 1953international. 1953international gründete sich 2006 anlässlich rassistischer Ausfälle während des Spiels gegen die Sportfreunde Siegen auf Initiative des Dresdner Fanprojektes. Eines ihrer Hauptziele ist, den Verein dafür zu sensibilisieren, dass Rassismus in den Fanblöcken ein ernst zu nehmendes Phänomen ist. Von 1953international stammt der Spruch: »Rassismus ist kein Fangesang und kein Normalzustand im Stadion.« Neben vielfältigen bunten Aktionen lädt die Gruppe regelmäßig Asylsuchende zu Dynamospielen ein. Sie tun dem Verein gut. In seiner Öffentlichkeitswahrnehmung sind sie ein Plus. Vermutlich hält die rechte Szene 1953international für nützliche Deppen. Auch der Verein Dynamo Dresden fährt inzwischen eine Linie gegen rechts. Nicht zu vergessen das Dresdner Fanprojekt. Das alles sind konstruktive Entwicklungen hin zum Erträglichen.
»Ihr habt eine Stunde Zeit, unsere Stadt zu verlassen.«
Mit diesem geschmeidigen Spruchband sendet Dynamo Dresdens K-Block nach dem verloren gegangenen entscheidenden Spiel gegen Arminia Bielefeld einen letzten Gruß an die eigenen Spieler, die Gästefans, die Dresdner, die Zuschauer an den Fernsehgeräten, die Ultras in den Ultraforen. Diese finale Botschaft ist ein Desaster für den Club. Schlimmer als der Abstieg wiegt die Botschaft, wenn’s nicht läuft, bekommen alle von Dynamo eins aufs Maul.
Der Platz wurde nicht gestürmt, kein Spieler wurde verprügelt. Vielleicht war die Ankündigung auch nur ein böser Scherz. Oder die große Ablehnung gewalttätiger Aktionen wirkte lähmend auf alle potentiellen Gewalttäter? Dynamos Fanszene 2014 ist zutiefst gespalten. In den Gesichtern der Fans lag Müdigkeit, Resignation, Leere.
Aus dem Nichts ein Monstergewitter, prasselnder Regen, Hagel. Wie um den Schmutz, den Schweiß und die ausgeträumten Fußballillusionen aus Dresden zu spülen.
An dem Tag ist trotzdem etwas Gutes in Dresden passiert.
03 Stahl Brandenburg auf dem Gipfel der Verzweiflung
»Der Kollege Fleischhauer bitte schleunigst zur Schicht!«
Bis 1989 konnte man im Stadion von Stahl Brandenburg immer wieder hören, wie der Stadionsprecher säumige Mitarbeiter zur Schicht ins Stahlwerk bat. Sie hatten schlichtweg vergessen, knuffen zu gehen. Die Arbeit lief ihnen nicht weg, der Fußball schon. Der Fußballclub und das Stahlwerk waren eins. In den siebziger Jahren haben die Brandenburger noch die Feuerwehr gerufen, wenn beim Abstich im Stahlwerk der Himmel in Flammen stand. Die Menschen dachten, ihre Stadt brennt. Nach der Schicht war Fußball, vor der Schicht war Fußball. Für den Stahlkocher genauso wie für den Generaldirektor des Qualitäts- und Edelstahlkombinats Brandenburg. Der hieß von 1979 bis 1986 Hans-Joachim Lauck und war ein Fußballverrückter. Er schuf den Nährboden für den kurzen Triumph seines Vereins und hievte die BSG 1986 in den Europapokal.
»Stahl Feuer!«, lautete der Schlachtruf der Anhänger, welcher lautstark und gern im Stadion als Wechselgesang intoniert wurde. Lauck holte künftige Stahlhelden wie Zimmer, Jeske, Ringk und Janotta in die Havelstadt. Stars mit natürlichen Mängeln. Etlichen von ihnen war die Karriere in DDR-Großclubs wegen familiärer Verbindungen in den Westen verwehrt. Wer Kontakte zum Klassenfeind hatte, galt in der DDR als unsicherer Kantonist. Böse Zungen munkelten von dicken Umschlägen, die in der Kabine den Besitzer wechselten. Schwarzgeldzahlungen als offenes Geheimnis. Das rief den DFV (Fußballverband der DDR) auf den Plan, der heimliche Prämienzahlungen und Sonderaufwendungen feststellte. Ende der Achtziger verdiente mancher Stahlkicker knapp 4.000 DDR-Mark monatlich. Inklusive Spezialprämien. Ein für DDR-Verhältnisse durchaus beeindruckendes Sümmchen. Den Stahlwerkern war das egal, die waren stolz auf ihre BSG und wollten guten Fußball sehen. 1986 wurde Lauck nach Berlin weggelobt. Offiziell 18.000, inoffiziell 22.000 Stahlwerker beweinten im selben Jahr das Aus in der zweiten Runde des UEFA-Cups gegen IFK Göteborg.
»Damals gab’s in Brandenburg über hundert Arbeiterstampen«, sagte Olaf und lächelte. Billiges, helles Bier, bei zu großer Hitze wurde es schnell sauer. Olaf hat die beinharten Aufstiegskämpfe der BSG Stahl Anfang der Achtziger mitgemacht. Einmal in Berlin, Olaf war gerade vierzehn. Stahl gewann, und eine Horde junger Brandenburger stürmte freudetrunken das Sportfeld. Erboste Berliner Rentner hinterher. Einer der Widerborste bohrte voll Wut über das verlorene Spiel einem jugendlichen Stahlfan die Spitze seines Regenschirms in den Hals. Es waren ruppige Zeiten, die schwielige Arbeiterhand saß überaus locker. Das bekam Olaf bei einem Heimspiel Stahls zu spüren. Nach dem Foul eines Stahlverteidigers an einem gegnerischen Spieler klatschte er Beifall. Daraufhin drehte sich ein Stahlwerker um und feuerte ihm eine. Es folgte eine Belehrung. Bei Fouls zu applaudieren sei unsportlich und gezieme sich für ehrliche Stahlarbeiter nicht. Brandenburg war Arbeiterstadt. 100.000 Menschen lebten zumeist vom Stahlwerk oder von Zulieferbetrieben. Der Stadtrivale hieß BSG Motor Süd Brandenburg und stand im Schatten Stahls. Zu Süd gingen die ehrlichen Getriebewerker, vielleicht auch, um den ehrlichen Stahlwerkern aus dem Weg zu gehen.
Читать дальше