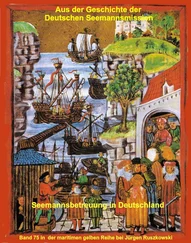«Besuch für Sie.»
Keine unangenehme Stimme, nicht kalt, nicht herrisch, keine Emotionen. Sie erreicht mich nicht.
Sechs Quadratmeter Wohnfläche: Klo in der linken hinteren Ecke, das Waschbecken in scheinbar gebührendem Abstand von ca. 20 cm daneben. Ich soll mir also nach der Entleerung die Hände waschen. Es ist schon komisch, dass man beim Bau meiner Einzimmerwohnung auf solche Feinheiten geachtet hat. Viele meiner Nachbarn haben diese Form von Hygiene nie eingehalten. Ich seit Jahren nicht mehr.
Ich schaue mich in meiner Wohnung um und registriere voller Selbstzufriedenheit eine gewisse persönliche Note. Ein Regal mit Büchern und exotischen Reiseandenken. Bilder, die ich gemalt und mit Tesafilm an der Wand befestigt habe. Sie sind grauenvoll. Ich kann nicht malen, aber ich liebe meine Bilder.
Über all die Jahre habe ich mir eine wunderschöne Angewohnheit aus meinem ersten Leben bewahrt. Einmal pro Woche lasse ich mir ein kleines Blumensträußchen schicken. Mein Blick bleibt an den Anemonen hängen. Sie stecken in einer Vase aus wasserdichtem Gummi und zieren meinen kleinen quadratischen Holztisch. Nein, mehr noch; sie strahlen Wärme in meine ganze Wohnung aus und lassen die Schlichtheit meines Bettes, meines Schrankes, ja sogar die schwere Eisentür vergessen.
Selbst wenn man mich ließe, hier möchte ich keinen Besuch empfangen. Hier ist meine Welt, hier ist mein Leben. Es hat lange, viel zu lange gedauert, meine Wohnung als mein Eigentum anzunehmen. Jetzt möchte ich sie mit niemandem mehr teilen.
«Kommen Sie, Frau Kello.»
Die Stimme meiner Lieblingswärterin reißt mich aus meinen Gedanken. ‹Lieblings›–Wärterin. Sie ist wohl doch kein emotionsloses Wesen. Sie hat sich mir zum Liebling gemacht. Wir leben beide noch.
«Wer ist es denn?», frage ich mit einer Stimme, die vom vielen Schweigen seltsam rau klingt und mich erschreckt.
«Es ist nicht ihr Mann», stößt sie mit einem heiseren Lachen hervor. «Ihr Besucher ist nüchtern.»
Das steht ihr nicht zu. Ich sollte sie maßregeln, darin war ich mal gut. Hier interessiert das niemanden.
«Sie kriegen ja nicht viel Besuch. Na ja, haben aber immer noch mehr Zulauf als der eine oder andere unserer ‹Gäste›», plappert sie vor sich hin.
«So einen hatten wir aber noch nicht», sinniert meine Lieblingswärterin Simone. «Er hat was und ist doch gruselig kaputt.»
Mein Interesse ist geweckt. Ich wundere mich, dass ich zu solchen Empfindungen noch in der Lage bin. Freue mich, erschrecke mich, will es von mir drängen, frage: «Hat er seinen Namen gesagt?»
«Nun kommen Sie, reden Sie mit ihm oder lassen Sie es bleiben, auch hier gibt es Freiheiten. Wollen Sie nun oder wollen Sie nicht?»
Ich betrete den Besucherraum und pralle zurück. Ich möchte schreien «bringen sie mich in meine Wohnung», bekomme jedoch keinen Laut hervor, glaube zu ersticken.
Er sitzt da, der gleiche mir ins Gedächtnis eingebrannte Blick: Abweisende Arroganz, Unnahbarkeit und hinter allem eine Spur von gefährlicher Feigheit. Ich möchte auf ihn einschlagen. Meine Hände ballen sich zu Fäusten. Ich nehme die Alarmbereitschaft meiner Wärterin wahr, lasse meine Hände sinken.
Sein Oberkörper ist steil aufgerichtet, soll Tatkraft und Willensstärke ausdrücken.
Der Rollstuhl steht ihm nicht.
«Warum sitzen Sie im Rollstuhl?», presse ich fiebernd hervor. Warum habe ich nicht gefragt Was wollen sie hier? Habe ihn nicht angeschrien, verschwinden sie, auf Rollen oder auf eigenen Beinen.
Sein Blick verändert sich. Meine Frage hat ihn getroffen. Schwäche zeigen war ihm schon immer verhasst.
Nach endlos schmerzendem Schweigen beantwortet er meine nicht gestellte Frage.
«Ich möchte Ihnen die Wahrheit der Ereignisse aufzeigen.»
«Ihre gefühlte Wahrheit ist nicht meine gelebte», zische ich ihn an.
Jetzt endlich kommt der Satz: «Verschwinden Sie», brülle ich.
Meine Lieblingswärterin hebt die Augenbrauen.
«Ich werde wiederkommen, oft wiederkommen. Wie sind hier die Besuchsregeln? Gibt es eine zeitliche Begrenzung?», fragt er ohne auf mein Hausverbot einzugehen.
Warum klärt sie ihn so ausführlich auf? Warum nimmt sie nicht wahr, dass ich diesen Menschen nie wieder empfangen möchte.
«Um Ihr Interesse zu wecken, habe ich ein paar Gedanken festgehalten. Lesen Sie! Ich bin morgen wieder hier.»
Wie bin ich in meine Wohnung zurückgekommen? Die eng beschriebenen Seiten liegen zerrissen vor meinem Bett. Warum habe ich sie überhaupt mitgenommen? Einzelne Wortfetzen starren mich an. Tu es nicht, sagt meine innere Stimme, bin hypnotisiert von einem Namen, der längst ausgelöscht ist, durch mich. Er sollte mich nicht mehr verfolgen und tut es doch immer wieder. Wieso ist ausgerechnet dieser Name von meiner Zerstörungswut verschont geblieben?
Langsam beginne ich die einzelnen Fragmente wieder zusammenzusetzen.
Mit jedem Wort wird mir schmerzhaft bewusst, dass ich mich meinem Besucher nicht entziehen kann, ja, dass ich seinem Besuch sogar entgegenfiebere. Ich werde mich auf seine Version der Geschehnisse einlassen, ohne mich ihr anzuschließen, schließlich war er, mein Kollege Wolter, einer der Hauptbeteiligten.
Nach einer qualvoll langen Nacht schleppe ich mich in die Druckerei, meinem Arbeitsplatz und verrichte die gleichen stereotypen Arbeiten wie jeden Tag. Ich will es nicht anders, habe geistig anspruchsvollere Tätigkeiten abgelehnt ebenso wie Formen der Weiterbildung. Ich habe Bildung genossen, weitere Bildung bringt mir für meine Zukunft hier an diesem Ort nichts ein.
Das Mittagessen schmeckt mir heute nicht. Scheinbar bin ich aber die einzige deren Geschmacksnerven auf Abschalten gestellt sind. Meine Tischnachbarn schaufeln in sich hinein, die üblichen lauten Gespräche sind verstummt. Ich fiebere dem Besuch von Wolter entgegen. Das Gefühl macht mich wütend, möchte es wegdrücken, kann es nicht.
Plötzlich steht meine Lieblingswärterin vor mir: «Haben Sie keinen Hunger? Sie haben ja kaum was gegessen; schmeckt doch lecker, Frau Kello», spricht sie mich fast fürsorglich an.
«Das hat der Rollstuhltyp, Wolter, Walter oder wie auch immer der heißt für Sie abgegeben.
Sie sollen es lesen. Er will in zehn Tagen wiederkommen. Komischer Kauz.» Meine Wärterin schüttelt den Kopf und legt mir eine provisorisch zusammengeheftete Mappe mit eng beschriebenen Seiten auf den Tisch.
Ich schiebe meinen Teller zur Seite, starre lange auf die Mappe. Nehme sie wie in Trance, halte sie mit gespreizten Fingern weit von meinem Körper entfernt und schleppe mich in meine Wohnung.
Erschöpft schmeiße ich mich auf mein Bett. Es stört mich, dass die Eisentür nicht verschlossen ist, um diese Zeit nicht verschlossen sein darf.
Ich kralle mich in meinem Kopfkissen fest, versuche mich zu wehren und taste doch langsam die Ränder meines Tisches ab, bis ich die Mappe erfühlen kann. Langsam fange ich an zu lesen und bin schockiert, wie schnell mich bereits die ersten Sätze in die Vergangenheit katapultieren.
«Sie ist da.»
«Wer?», fragte Herr Schiesser, scheinbar eher gelangweilt als interessiert. An Spekulationen, Intrigen, Grüppchenbildungen, die nur dem jeweiligen inneren Kreis etwas zu bieten hatten, nahm er nie teil. Man täuschte sich jedoch, wenn man annahm, dass er die jeweiligen Strömungen nicht genau wahrnahm. Auf ihn war Verlass. In schwierigen Situationen blieb er ruhig, auch wenn man ihm ansah, dass auch er mit zunehmendem Alter an seine Grenzen stieß.
«Na, unsere neue Chefin, Frau Kello», flüsterte Frau Retlaw. Aufgeregt fistelte sie an ihrem Rocksaum herum, ein Rock, den sie selbst genäht hatte, der aber bei ihren Schülern, wie auch ihre gesamte Art sich zu kleiden, nicht ankam. Hektische rote Flecken breiteten sich vom Hals über ihr Gesicht aus.
Читать дальше