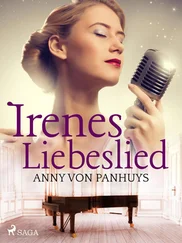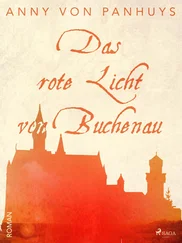Fernande Romstedt richtete sich auf und salbungsvoll belehrte sie:
„Es gibt auch Verwandte des Herzens. Liebe Freunde stehen einem im Leben oft näher als leibliche Verwandte.“
Liane verstand die Anspielung und ging schweigend, das gewünschte Kleid zu holen.
Frau Fernande überzog inzwischen ihr vom Weinen etwas erregtes Gesicht mit einer frischen Puderschicht, fuhr mit der Bürste leicht über die tief eingebrannten Wellen ihrer rostrot gefärbten Haare und ließ sich dann von der inzwischen zurückgekehrten Liane in das düstere Trauergewand und den dazu passenden Hut helfen.
Nach vollendetem Werk drehte sie sich langsam vor dem Spiegel hin und her. Dabei heiterten sich ihre Mienen zusehends auf.
„Trauer steht mir vorzüglich, nicht wahr, Liane? Es macht mich jünger. Mein Haar hebt sich wie dunkles Gold aus dem schwarzen Schleier.“
Lianes Gefühl empörte sich, sie erwiderte hastig:
„Ja, ja, Tante.“
Und fragte gleich, ob sie sich nun ebenfalls zum Ausgehen zurechtmachen dürfe.
Frau Romstedt nickte gnädig, sie hatte noch genug mit ihrem Spiegelbild zu tun. Sie litt zuweilen an solchen Eitelkeitsanwandlungen, die ihre Umgebung heimlich belächelte.
Aber Liane stand heute nicht der Sinn danach, darüber zu lächeln, sie fühlte, wenn sie auch in keinen Tränenstrom ausbrach, ein tiefes Weh im Herzen ob der Todesnachricht. Die gute Frau Rikow war tot, die verehrte Dame, die stets freundlich und liebevoll zu ihr gewesen und sie oft getröstet, wenn sie es der Tante Fernande wieder einmal gar nicht recht machen konnte. Und wie oft gab es solche Tage in den zwei Jahren, seit sie im Romstedtschen Hause Aufnahme gefunden, ach, wie gar oft gab es solche Tage.
Gern und freudig war sie nach dem Tode der Eltern, die kurz nacheinander gestorben waren, mit der Tante gegangen, unzählige gute Vorsätze hatte sie in ihr neues Leben mitgenommen, und doch wurde sie allmählich immer zaghafter und unsicherer in allem, was sie tat. In manchen Augenblicken trat sogar die Versuchung an sie heran, sich bei fremden Menschen einen Wirkungskreis zu suchen, die kleinliche Quälerei der Tante verdarb ihr jede frohe Stunde.
Wenn Onkel Friedrich nicht gewesen wäre, hätte sie auch wahrscheinlich nicht standgehalten. Wenn er nicht gewesen wäre, er und die alles verstehende Frau Anna Rikow. Die Gütige, Mütterliche war nun aus der Welt gegangen, und niemals würde ihre weiche liebe Stimme zu ihr mehr sagen:
„Lassen Sie nur, Kindchen, und grollen Sie nicht, wenn Ihnen auch Unrecht geschieht. Das nimmt auch ein Ende, alles ändert sich einmal, und schließlich, die Fernande meint es nicht so böse. Es liegt so in ihr, Menschen zu piesacken, das tat sie zuweilen schon in ihren jüngsten Jahren gar zu gern. Im innersten Herzen ist sie nicht schlecht, glauben Sie es mir, ich kenne sie besser als sonst jemand.“
Die Erinnerung in Liane war so lebendig, daß sie fast die Stimme der nun Toten zu hören glaubte. Sie fuhr sich über die Augen, aus denen sich jetzt ein paar heiße Tränen drängen.
Nicht weinen, nicht weinen! dachte sie, für die arme Frau war der Tod ja als Erlöser gekommen, schon seit Jahren siechte sie an einem heimtückischen Herzleiden dahin.
„Bist du noch nicht bald fertig?“
Die scharfe Stimme der Tante scheuchte ihre Gedanken jählings in die Flucht.
„Jawohl, Tante, ich komme.“
Sie fuhr sich noch einmal schnell über die Augen und eilig, ohne einen einzigen Blick in den Spiegel zu werfen, zog Liane den einfachen grauen Herbstmantel an und setzte den gleichfarbenen Filzhut auf das dicke blonde Wellenhaar.
Schweigsam machten sich die beiden Damen auf den Weg.
Im schwarzen Schleier und stumpfen Krepp sah Frau Fernande aus wie eine tieftrauernde Witwe, während Liane neben ihr herschritt wie eine bescheidene Gesellschafterin.
In der vornehmen, belebtesten Ladenstraße des westlichen Berlins, der Tauentzienstraße, befindet sich das Geschäft des Juweliers Franz Bendemann.
Der Inhaber desselben stand in dem sehr neumodisch ausgestatteten Verkaufsraum und legte eben einem schlanken Herrn von vornehmstem Typ Armbänder vor. Dieser Herr saß vor einem längeren Tisch, über den eine mattlila Samtdecke gebreitet war. Auf diese schimmernde mattlila Decke legte Franz Bendemann die goldenen, mit wertvollen Edelsteinen besetzten Armketten und Reifen.
„Ich hätte meiner Braut gern etwas ganz Besonderes zu ihrem Geburtstage geschenkt“, äußerte der schlanke, vornehme Herr, „wissen Sie, so geschmackvoll auch alles ist, finde ich darunter diesmal leider doch nicht das, was ich suche.“
Franz Bendemann verneigte sich geschmeidig.
„Verstehe, Herr Direktor, verstehe vollkommen, aber Sie haben doch noch stets etwas bei mir gefunden, Herr Direktor. Es täte mir sehr, sehr leid, Ihnen diesmal nicht dienen zu können.“
Er schüttelte den Kopf. „Nein, nein, es muß mir gelingen, Sie auch diesmal zufrieden zu stellen.“
Er holte einen breiten, seidengepolsterten Kasten herbei und öffnete ihn. Mit spitzen Fingern langte er ein ziemlich breites goldenes Kettenarmband daraus hervor, an dem verschiedene kurze Goldkettchen hingen, daran kleine groteske Götzen baumelten.
„Hübsch, sehr hübsch“, lobte Bankdirektor Walter Felden, „wirklich sehr hübsch. Ich nehme das Ding, es dürfte meiner Braut gefallen.“
„Das glaube ich auch, Herr Direktor, jedenfalls bin ich froh, daß ich Ihnen wieder dienen konnte.“
Bendemann räumte geübt und schnell die Armbänder in ihre Behälter zurück und verschloß diese in einen hohen Wandschrank.
Direktor Felden zahlte und wollte sich schon entfernen, da bat ihn Franz Bendemann, noch einige Minuten zu verweilen.
„Ich möchte Ihnen nämlich etwas ganz Apartes zeigen“, sagte er lächelnd, „weil ich weiß, daß Sie aparte Schmuckstücke lieben, Herr Direktor.“
Er verschwand einen Augenblick in einen neben dem Laden gelegenen Raum, um gleich wieder mit einem aus dunklem Ebenholz geschnitzten Kästchen zurückzukehren.
Ganz langsam öffnete er das Kästchen, hob mit beinahe übertriebener Sorgfalt eine ungefähr drei Zentimeter hohe Götzenfigur daraus hervor und hielt sie Walter Felden entgegen.
Der konnte einen Ausruf des Entzückens nicht zurückhalten.
„Welch köstliche Arbeit“, lobte er begeistert, „das Anhängerchen muß ich haben, es paßt prächtig an das Armband, gewissermaßen als Mittelpunkt, um den sich die kleineren Götzen gruppieren.“
Franz Bendemann schüttelte bedauernd den tadellos gescheitelten Kopf.
„Es tut mir außerordentlich leid, Herr Direktor, aber über das Schmuckstück habe ich kein Verfügungsrecht. Eine Dame übergab es mir zur Reparatur. Sehen Sie“, er deutete mit dem langen, sorgfältig gefeilten und polierten Nagel des kleinen Fingers auf eine Stelle des edelsteinglitzernden Figürchens: „Hier, dieser Rubin ist locker und muß neu gefaßt werden.“
„Wem gehört denn der Götze?“ fragte der Direktor, „möglicherweise ist er verkäuflich. Ich beabsichtige nicht zu knausern, in keiner Weise, aber ich muß den Götzen haben.“
Abermals schüttelte Franz Bendemann den Kopf.
„Es läßt sich nicht machen, Herr Direktor, die Besitzerin der Schmuckstücke ist sehr reich. Ihr Gatte war lange Jahre Teilhaber einer großen Tabakfarm auf Java, und der Götze ist das Geschenk eines indischen Fürsten an die Dame.“
„Ich werde sofort zu der Dame hinfahren“, entschloß sich Walter Felden rasch, „ich will mit ihr sprechen, sie muß mir einfach den Götzen verkaufen, sie muß.“
Der Juwelier machte ein sehr erschrecktes Gesicht.
„Verzeihen Sie, Herr Direktor, aber ich möchte ergebenst bitten, das nicht zu tun. Die betreffende Dame ist etwas nervös und es wäre leicht möglich, daß sie sich darüber ärgern würde, weil ich ihr Eigentum jemandem ohne ihre Erlaubnis zeigte. Das könnte mich — unter uns gesagt — um die wirklich noble Kundschaft der Dame bringen.“
Читать дальше