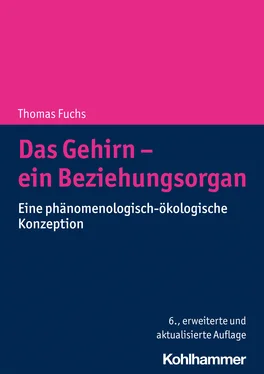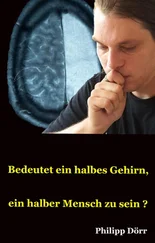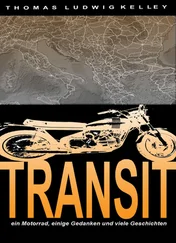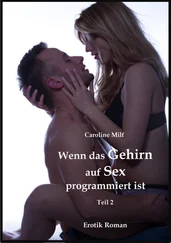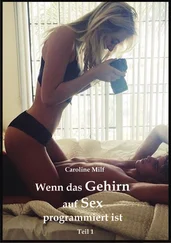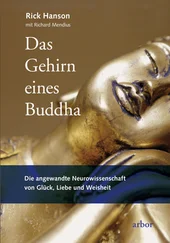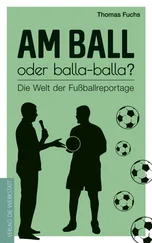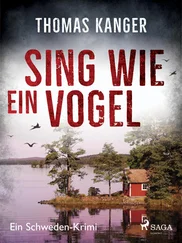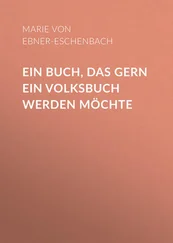1.2.2 Koextension von Leib und Körper
Vergegenwärtigen wir uns zunächst die Tatsache, dass wir den subjektiven Leib und den organischen Körper normalerweise als koextensiv erfahren: Der empfundene Schmerz sitzt dort, wo auch die Nadel den physischen Körper gestochen hat. Der Töpfer fühlt den Ton genau da, wo seine Hand ihn tatsächlich presst und formt. Und zeigt der Patient dem Arzt seinen schmerzenden Fuß, so wird dieser auch dort nach der Ursache suchen. Wäre die subjektive Leiberfahrung nur eine Illusion, könnte er die Aussage des Patienten auch ignorieren und stattdessen sein Gehirn untersuchen. Es gibt also eine räumliche Übereinstimmung oder Syntopie von Leiblichem und Körperlichem.
Diese Syntopie hat bereits Husserl analysiert, nämlich an folgendem Beispiel: Streift eine Nadel objektiv sichtbar über meine Hand oder sticht sie, so empfinde ich dies gleichzeitig und gleichörtlich als Berührungsverlauf bzw. als Schmerz:
»So liegt in den Empfindungen eine sich mit den erscheinenden Extensionen ›deckende‹ Ordnung … [die Hand] ist von vornherein apperzeptiv charakterisiert als Hand mit ihrem Empfindungsfeld, mit ihrem immerfort mitaufgefaßten Empfindungszustand, der sich infolge der äußeren Einwirkung ändert, das heißt als eine physisch-aesthesiologische Einheit« (Husserl 1952, 154 f.).
In der »Kompräsenz« (ebd., 161) des in der objektiven und in der subjektiven Einstellung Gegebenen konstituiert sich der Leib somit als die koextensive Einheit beider Aspekte. Das Phänomen der Phantomschmerzen zeigt uns zwar, dass im Ausnahmefall Organismus und Gehirn auch ohne das betreffende Glied eine Schmerzempfindung hervorbringen können, macht aber den Normalfall nicht weniger erstaunlich: Wie ist es eigentlich möglich, dass wir den Schmerz tatsächlich da empfinden, wo sich auch der dazu passende verletzte Körperteil befindet – und nicht im Gehirn?
Die Koextension von Subjektleib und organischem Körper kann nicht etwa durch eine »Projektion« von Leibempfindungen in den Raum des Körpers erklärt werden, denn der objektive Raum des Körpers hätte in einer virtuell-subjektiven Welt gar keine Existenz. Eine Projektion »nach außen« kann es nicht geben, wenn diese Außenwelt doch nach der Voraussetzung nur eine vom Gehirn konstruierte Innenwelt sein soll. Die früher noch üblichen Projektionskonzepte sind daher in den kognitiven Neurowissenschaften weitgehend zugunsten eines einheitlichen virtuell-phänomenalen Raums, eines »Phenospace« 22 226aufgegeben worden. Konsequenterweise muss dann allerdings auch der sichtbare Nadelstich, der den Schmerz erzeugt, zu einem virtuellen Konstrukt oder einer Simulation des Gehirns erklärt werden. Wir hätten dann überhaupt keinen Zugang zur eigentlichen Realität.
Doch sobald wir in eine intersubjektive Situation eintreten wie der erwähnte Patient beim Arztbesuch, wird sofort deutlich, dass subjektives Erleben und objektive Situation, also Schmerzempfindung und feststellbare körperliche Ursache, keineswegs zwei getrennten Welten angehören. Die »Syntopie« oder das Zusammenfallen des Ortes von Schmerz und Verletzung betrifft nämlich jetzt den von Arzt und Patient gemeinsam wahrgenommenen Körper: Dort, wo der Patient den Schmerz empfindet und wohin er deutet, findet der Arzt auch dessen Ursache, z. B. einen Stich oder eine Prellung. Beide sehen den gleichen Fuß, der subjektiv schmerzt und objektiv verletzt ist. Wie ist das möglich?
Der Verweis auf den jeweiligen »Phenospace« von Arzt und Patient hilft nun nicht mehr weiter – wenn die Rede von einer Realität des Körpers überhaupt irgendeinen Sinn haben soll, dann in der intersubjektiven Situation. Denn hier kommen die subjektiven Räumlichkeiten beider Personen in einer Weise zur Deckung, die ihre bloße Subjektivität aufhebt. Das Argument dafür ist folgendes:
Da jedes Gehirn nach der neurokonstruktivistischen Voraussetzung nur seinen eigenen virtuellen Raum produziert, kann es keinen »gemeinsamen Phenospace« von Arzt und Patient geben. Mit anderen Worten: Ließe sich Wahrnehmung restlos als ein physikalischer Prozess beschreiben, der sich jeweils zwischen einem Gegenstand und einem Gehirn abspielt, dann könnten zwei Menschen nicht gemeinsam ein- und denselben Gegenstand betrachten. Die zwei Prozesse liefen, vom Objekt ausgehend, in verschiedene Richtungen und streng getrennt voneinander ab, und die beiden Personen blieben in ihre jeweilige Welt eingeschlossen, zumal sie ja auch selbst für einander nur Simulationen wären. Das aber liefe auf einen Neuro-Solipsismus hinaus.
Insofern also der intersubjektiv konstituierte Raum Objektivität besitzt – besäße er sie nicht, dann wäre keine Verständigung über gemeinsam wahrgenommene Objekte möglich, ja nicht einmal ein schlichter Warenaustausch wie beim Einkaufen – erweist er umgekehrt die jeweiligen subjektiv erlebten Räume, auf deren Basis er sich konstituiert, als nicht nur virtuell. Die subjektive Sicht ist also zwar eine je individuelle, perspektivische Sicht, jedoch nicht etwa »nur subjektiv« in dem Sinne, als wäre das Gesehene »im Subjekt«. Sehend befinden wir uns immer schon in einem gemeinsamen Raum mit anderen (vgl. Fuchs 2020a).
Der von Arzt und Patient übereinstimmend wahrgenommene Körper kann also kein subjektives Scheingebilde mehr sein. Er befindet sich im gemeinsamen, intersubjektiven und insofern objektiven Raum. Nun passt aber die subjektive Stelle des Schmerzes zum objektiven Ort des Körperteils. Der subjektiv-leibliche und der objektive Raum kommen also tatsächlich zur Deckung, und wir müssen die Frage wiederholen: Wie ist es möglich, dass der Patient den Schmerz dort empfindet und nicht im Gehirn?
Schon die Richtung der Frage zeigt freilich, dass wir in cartesianischer Tradition noch immer gewohnt sind, Subjektivität vom lebendigen Organismus kategorial zu trennen. Evolutionär verhält es sich gerade umgekehrt: Ursprünglich ist der ganze Körper gewissermaßen ein Sinnes- und Fühlorgan. Gerade an seinen Grenzflächen mit der Umgebung ist der Organismus reizbar, sensibel und responsiv. Die elementare Sensibilität beginnt an der Peripherie des Körpers. 23 Die Ausbildung eines nervösen Zentralorgans hebt diese periphere Sensibilität nicht auf, sondern integriert sie. Dass das leibliche Bewusstsein mit dem Organismus koextensiv bleibt, zeigt, dass es gerade nicht als eine außerweltliche Entität aus ihm entspringt wie Athene aus dem Haupt des Zeus, sondern vielmehr von Anfang an verkörpertes Bewusstsein ist. Es stellt das »Integral« über dem lebendigen Organismus insgesamt dar, nicht ein im Gehirn produziertes Phantom.
Die Koextension von subjektivem Leib und organischem Körper ist so gesehen nicht mehr verwunderlich. Sie ist aber auch funktionell sinnvoll: Das bewusste Erleben ist dort, wo die Interaktionen mit der Umwelt stattfinden – in der Peripherie, nicht im Gehirn. Schließlich ist der Körper der »Spieler im Feld«. Daher ist es sinnvoll, dass wir seine Grenzen, Stellungen und Bewegungen in der Umwelt »analog«, d. h. leibräumlich erleben und nicht nur kognitiv registrieren.
Theoretisch wäre es auch denkbar, dass Schmerzen uns ortlos zu Bewusstsein kämen wie Gedanken oder Erinnerungen. Doch ohne die Koinzidenz der beiden Räume hätten wir unseren Körper nur als ein äußerlich zu hantierendes Werkzeug und wären nicht in ihm »inkarniert«. Nur weil das Bewusstsein in der schmerzenden Hand ist, zieht man sie unwillkürlich vor der Nadel zurück. 24 Nur weil die Empfindung des Töpfers in seiner tastenden Hand ist, und er dort die Struktur des Tones spürt, kann er ihn auch geschickt formen. Eine bloße »zentrale Verrechnung« im Gehirn könnte niemals leisten, was die unmittelbare Präsenz des Subjekts in seiner Hand ermöglicht, nämlich die Verknüpfung von Wahrnehmung, Bewegung und Objekten in einem gemeinsamen Raum: »Mein Leib ist da, wo er etwas zu tun hat« (Merleau-Ponty 1966, 291). Wir können insofern von einer nicht nur verkörperten, sondern auch »ökologischen Subjektivität« sprechen (Bateson 1981, Neisser 1988).
Читать дальше