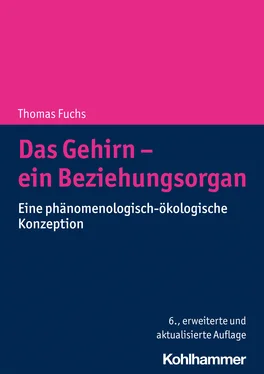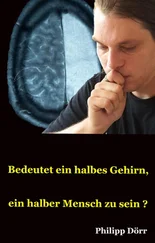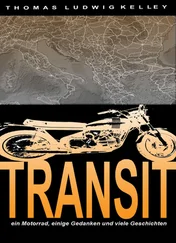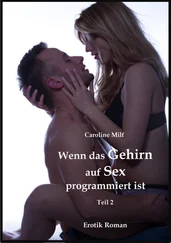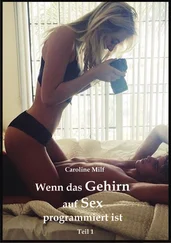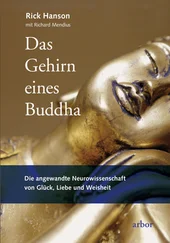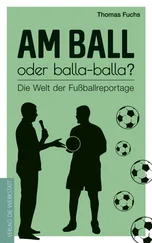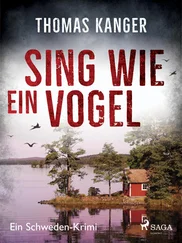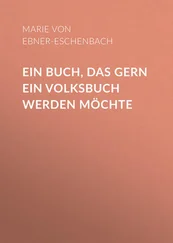Fassen wir vorläufig zusammen: Wir gingen aus von der Überlegung, dass Wahrnehmung nicht die passive Aufnahme von Bildern in ein außerweltliches Bewusstsein bedeutet. Alles Wahrnehmen ist vielmehr verkörpert: Es beruht auf dem sensomotorischen Umgang mit den Dingen, auf konkreter leiblicher Praxis. Das Subjekt der Wahrnehmung, so zeigte sich weiter, ist ausgedehnt über den leiblichen Raum, und dies nicht in Form eines bloßen Phantoms oder Gehirnkonstrukts, sondern als die mit dem lebendigen Organismus koextensive, verkörperte Subjektivität. Die somatosensorischen und -motorischen Strukturen im Gehirn sind freilich notwendige Bedingungen dieses Subjekterlebens. Doch bedeutet dies nicht, dass das Leibsubjekt im Gehirn zu lokalisieren wäre wie Descartes’ Seele in der Zirbeldrüse. Wir gehören der Welt an, mit Haut und Haaren – wir sind leibliche, lebendige und damit »organischere« Wesen als es der neurowissenschaftliche Zerebrozentrismus suggeriert.
1.3 Zweite Kritik: Die Objektivität der phänomenalen Welt
1.3.1 Der Raum der Wahrnehmung
Was für die eigenleibliche Wahrnehmung gezeigt wurde, gilt es nunmehr auf die Wahrnehmung insgesamt auszudehnen. Trifft hier nun doch die Illusionsthese zu? Sehen wir in Wahrheit nur Bilder, passend konstruiert und auf den Schirm unseres Bewusstseins projiziert von der Camera Obscura des Gehirns?
Natürlich verhält es sich phänomenal ganz anders: Beim Sehen, wie bei jeder anderen Sinneswahrnehmung, sind wir nicht im Kopf, sondern in der Welt und bei den Dingen. Wahrnehmung findet auch nicht in einem Behälter namens Bewusstsein statt, in den Sinnesreize von außen importiert würden. Ich nehme nicht »Sehempfindungen« oder Bilder wahr, sondern den Schreibtisch, das Fenster, den Himmel usw. Ich höre keine »Schallempfindungen«, sondern Musik. Wahrnehmung stellt eine unmittelbare Beziehung zwischen dem Wahrnehmenden und dem wahrgenommenen Gegenstand her. Ist diese Unmittelbarkeit unserer Welterfahrung wirklich nur eine Täuschung?
Das Problem, wie es überhaupt zu einer phänomenalen Welt kommt und welche Funktion sie hat, beschäftigt auch die kognitiven Neurowissenschaften. Warum, so fragt etwa Prinz, nehme ich eigentlich nicht die Reizungen meiner Netzhaut, die Aktionspotenziale meiner Sehnerven oder direkt meine Hirnzustände wahr, wenn sie doch das tatsächliche Substrat meiner Wahrnehmung sind? 34 Und warum plane ich Handlungen und nicht direkt die entsprechenden neuromuskulären Prozesse meines Körpers? Mit anderen Worten: Warum gibt es überhaupt »distale« und nicht »proximale Repräsentationen«? – Die Erlebniswelt, so lautet Prinz’ Antwort, stellt einen »virtuellen Raum« dar, in dem die verschiedenen sensorischen und motorischen »Datenformate« einander angeglichen und integriert werden. In diesem Raum können wir also zugleich wahrnehmen, Ziele erkennen und handeln, ohne vom Wissen um die »tatsächlich« ablaufenden physiologischen Prozesse belastet zu sein.
Freilich liegt schon in Prinz‹ Frage ein Kategorienfehler, nämlich die Verwechslung von kausaler und intentionaler Ebene: Wir nehmen Lichtwellen ebenso wenig wahr wie Nervenerregungen, weil sie eben nur die physischen Trägerprozesse der Wahrnehmung darstellen und nicht die Wahrnehmung selbst. Was der Wahrnehmung als vermittelndes Substrat zugrunde liegt, kann schwerlich selbst zu ihrem Gegenstand werden. Zudem erkennt Prinz mit seiner Antwort an, dass gerade die phänomenale Welt uns Orientierung und Handeln in der Welt ermöglicht; dann bleibt nur unerfindlich, warum er sie als »virtuellen Raum« bezeichnet. Immerhin erlaubt sie uns, über einen gesehenen Graben zu springen und mit den Füßen tatsächlich auf der anderen Seite anzukommen. Ihr zugrunde liegt ein »sensus communis«, also ein gemeinsamer Rahmen für die verschiedenen Sinne und Bewegungen, so dass etwa die Person, die ich sehe, ihre Stimme, die ich höre, und ihre Hand, die ich schüttle, dem gleichen Raum angehören – und das ist ja wohl auch tatsächlich der Fall. 35 Für eine »Scheinwelt« verfügt die Erlebniswelt also über ein erstaunliches Maß an Objektivität. Betrachten wir dies noch etwas näher.
1.3.2 Die objektivierende Leistung der Wahrnehmung
Was wir wahrnehmen, sind weder Bilder noch Modelle, sondern Dinge und Menschen. Das ist zunächst keineswegs selbstverständlich: Wenn ich beispielsweise ein Haus wahrnehme, dann sehe ich doch eigentlich immer nur eine, perspektivisch begrenzte Ansicht des Hauses. Wie überwindet die Wahrnehmung diese Begrenztheit?
Husserl hat gezeigt, dass die Wahrnehmung ihre Gebundenheit an eine Perspektive aufhebt, indem sie weitere mögliche Aspekte der Dinge integriert (Husserl 1950, 91 ff.). So nehmen wir nicht nur die sichtbare Seite des Hauses wahr, sondern wir sehen auch seine anderen Seiten »mit hinzu«, die wir beim Herumgehen um das Haus erblicken würden. Wir nehmen auch seine Materialität mit wahr, ebenso wie die Möglichkeiten des Handelns, die es uns bietet (z. B. darauf zulaufen, die Türe öffnen, die Treppe hinaufgehen, usw.). Alle diese impliziten Gehalte unserer Wahrnehmung leiten sich von früheren Erfahrungen ab, die wir im Umgang mit Häusern gemacht haben. Daher beruht meine Wahrnehmung eines Objekts auf einem Horizont möglicher Erfahrungen mit diesem Objekt, der jetzt implizit mitgegeben oder »appräsentiert« ist, wie Husserl es ausdrückt. Das heißt, es ist mein verkörperter Umgang mit der Welt, der es mir ermöglicht, das Haus selbst zu sehen, und nicht einen bloßen Empfindungseindruck oder ein subjektives Bild.
Doch es gibt noch eine andere Ebene der Objektivität, die für die menschliche Wahrnehmung charakteristisch ist. Denn wir nehmen das Haus nicht nur als Gegenstand möglichen Handelns wahr, sondern auch als unabhängig von unserer momentanen Wahrnehmung existierend. Die Dinge sind ja nicht nur »für mich« da, in der Immanenz meiner Subjektivität, sondern sie sind mir als solche gegeben. Wie ist diese Unabhängigkeit möglich? – Husserls spätere Antwort verweist auf die Intersubjektivität der Wahrnehmung: Das Haus, das ich dort sehe, ist auch ein möglicher Gegenstand für andere, die es gleichzeitig von anderen Seiten sehen könnten. Somit gewinnt der Gegenstand seine eigentliche Objektivität für mich erst durch die implizit vorausgesetzte Pluralität anderer Perspektiven. Husserl spricht hier auch vom »Horizont möglicher eigener und fremder Erfahrung« oder von einer »offenen Intersubjektivität« (Husserl 1973, 107, 289). Die Pluralität möglicher Subjekte entspricht der Pluralität von Aspekten, die ein Gegenstand aufweist. Alle könnten dieses Haus jetzt sehen. Selbst Robinson sah seine Insel immer auch mit den Augen der anderen, noch bevor Freitag auf den Plan trat. Im Wahrnehmen bewohnen wir immer schon einen Raum, den wir mit anderen teilen. 36
Wie wir sehen, bedeutet die Perspektivität der Wahrnehmung keineswegs bloße Subjektivität oder Virtualität. Im Gegenteil, durch die Interaktion mit den Dingen und durch unsere Interaktionen mit anderen sind wir in der Lage, unsere primäre Subjektivität aufzuheben. Die Gestaltpsychologie hat darüber hinaus gezeigt, wie die Wahrnehmung Fragmente zu Ganzheiten vervollständigt (z. B. fehlende Buchstaben zum Wort ergänzt), Farb- oder Formkonstanzen auch dort herstellt, wo das Wahrnehmungsfeld diskontinuierlich oder verzerrt ist (so sehen wir ein schräg gestelltes Rechteck nicht als Rhombus, sondern immer noch als Rechteck), ja dass sogar die Illusionen der Wahrnehmung auf Ausgleichsprozessen beruhen, die normalerweise der objektiven Wiedergabe der Umwelt dienen. Neurokonstruktivisten führen solche Illusionen gerne ins Feld, um die Virtualität der Wahrnehmung zu erweisen. In Wahrheit verhält es sich umgekehrt: Gerade die aktiv gestaltende, intentionale Struktur unserer Wahrnehmung befähigt uns, nicht bloße »1:1-Abdrücke« von Reizen zu empfangen, sondern wirkliche Dinge zu erkennen.
Читать дальше