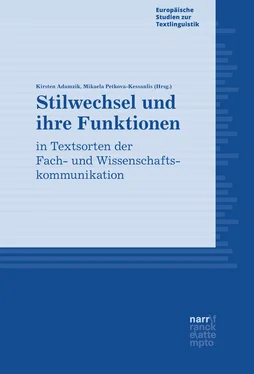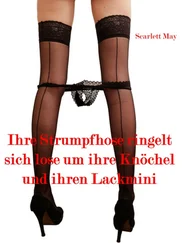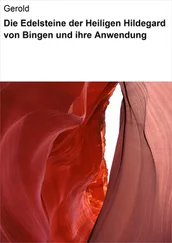Die vorgestellten Textbeispiele stellen relativ typische Makrostrukturen von popularisierenden Texten aus dem Computerbereich vor. Es wird ersichtlich, dass es in einem – im weitesten Sinn – als Wissenschaftsjournalismus zu verstehenden popularisierenden Genre darum geht, technische Neuerungen verständlich und interessant darzustellen. Es kommt zu einem Stilmix aus Alltagssprache, Fachsprache und Journalismus. Besonders in den digital veröffentlichten Texten wird ein sehr starker Übergang von Schriftsprache zu Mündlichkeit (z.B. durch episodenhafte Erzählungen) und zu Alltagssprachgebrauch deutlich. Es ist zu vermuten, dass diese Art der Versprachlichung mit der Vereinfachung von komplexen Sachverhalten durch die Suche nach Analogien, Vergleichen und den Lesern vertrauten Situationen zusammenhängt. Makrostrukturell wird auch versucht, verschiedene Genres zu vereinen (Bericht, Erzählung, Interview), was eine deutliche Abweichung von der Stringenz einer wissenschaftlichen Abhandlung darstellt und für Stilwechsel auf der Textebene spricht.
Die exemplarische Analyse von Texten, die sich mit wissenschaftlich-technischen Neuerungen auseinandersetzen, hat zunächst gezeigt, dass neue Technikkonzepte (z.B. smart, IoT ) und die damit im Zusammenhang stehenden Fachbegriffe häufig aufgrund fehlender Übersetzungen direkt aus dem Englischen in deutsche (popularisierende) Texte übernommen werden. Da ihr Begriffsumfang, ihre Definition und ihr Verständnis meist noch einer fachlichen Präzisierung bedürfen, bleiben sie oft vage und werden auch in Blogtexten zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Es gibt derzeit keine klare Tendenz, ob die aus dem Englischen stammenden Fachbegriffe besser übernommen werden sollten oder ob es besser verständnisfördernde Übersetzungen geben sollte. Vielleicht ist es an dieser Stelle sinnvoll, Autoren die von der Textakademie1 formulierten drei Faustregeln für die Verwendung von englischen Wörtern an die Hand zu geben:
(1) Verwenden Sie ein englisches Wort, wenn es im Deutschen keinen passenden Ersatz gibt.
(2) Nutzen Sie ein englisches Wort, wenn ihr Produkt global gedacht und vermarktet wird.
(3) Setzen Sie nur auf ein englisches Wort, wenn Sie sicher sind, Ihre Zielgruppe versteht dieses Wort oder kann es – bei Marken und Produktnamen – zumindest richtig aussprechen.
Betrachtet man den Textaufbau und die Funktion der untersuchten Texte, lässt sich feststellen, dass sie in der Regel eine kommunikative Mehrfachfunktion erfüllen. Sie liefern Informationen zu neuen Entwicklungen, versuchen zur Verständlichkeit von Fachbegriffen beizutragen und aufzuklären, aber werden auch dazu genutzt, indirekt Werbung für eine Entwicklung, ein Unternehmen oder einen Prozess zu machen und diesen entsprechend über Argumentationsketten positiv zu vermarkten. Bei der Darstellung von Neuentwicklungen, die einen komplexen Charakter tragen oder Ängste provozieren (könnten), vollzieht sich in der Regel ein Stilwechsel vom Schriftsprachstil zum mündlichen Kommunikationsstil, der eine Vielzahl journalistischer Züge trägt: Überspitzte Überschriften, die als Leseanreiz dienen; Bilder, die durch Größe, Abstraktheit, Farbkombination auffallen; reale oder fiktive Episoden und/oder Interviews, die in direkter/indirekter Rede wiedergeben werden; veranschaulichende Beispiele, Vergleiche zum Alltag und Verlinkung zu multimedialen Elementen (Animationen, Videos) als Zusatzinformationen und Hypertextverknüpfungen. Die zeitnahe Reflexion von wissenschaftlichen Informationen führt zudem zu einer neuen Qualität des (populär-)wissenschaftlichen Austauschs, wobei die Akteure für die sprachlich-stilistischen Veränderungen nicht so stark sensibilisiert zu sein scheinen, was sich z.B. im Gebrauch von Jargonausdrücken und Alltagssprache äußert.
In ihrer Summe wirken die Sprach- und Stilmittel auch als Ausdruck von Bildungssprache, d.h. zur Vermittlung zwischen Fachlichem und Alltäglichem.
Die im Internet veröffentlichten Blogtexte helfen bei der Rezeption von Fachinhalten, können aber nicht als deren Ersatz dienen, da die teilweise auch verkürzt dargestellten Informationen zu Halbwissen über Sachverhalte beitragen können. Folglich sind die Leser aufgefordert, das Rezipierte auch kritisch zu hinterfragen und über weitere Informationsquellen den Wahrheitsgehalt in Zeiten der Informationsflut zu überprüfen.
Die in der forsa-Umfrage (2014) benannten Auswirkungen der Digitalisierung auf die deutsche Sprache scheinen sich durch die exemplarische Analyse der Texte in diesem Beitrag tendenziell zu bewahrheiten. Um reliabel Aussagen treffen zu können, sind jedoch erheblich größere Datenmengen zu untersuchen und ihre Ergebnisse zu dokumentieren. Damit erschließt sich für die Angewandte Linguistik ein interessantes Forschungsfeld zur Auswirkung von Digitalisierung auf die Sprache und auf Texte sowie das Texten und die Rezeption.
Insgesamt ist festzustellen, dass der Facettenreichtum der Kommunikation über Wissenschaft und Technik über Medialisierung, Digitalisierung und auch Kommerzialisierung deutlich gewachsen ist. Es wird daher auch weiterhin Aufgabe des Wissenschaftsjournalismus und der Linguistik sein, diese Prozesse entsprechend zu begleiten und sowohl quantitativ als auch qualitativ zu bewerten.
Adamzik, Kirsten 2010: Wissenschaftstexte im Kulturvergleich. Probleme empirischer Analysen. In: Marina Foschi Albert / Marianne Hepp / Eva Neuland / Martine Dalmas (Hg.): Text und Stil im Kulturvergleich. München, 137–153.
Auer, Peter / Baßler, Harald (Hg.) 2007: Reden und Schreiben in der Wissenschaft. Frankfurt a.M.
Berg, Helene 2018: Wissenschaftsjournalismus zwischen Elfenbeinturm und Boulevard. Eine Langzeitanalyse der Wissenschaftsberichterstattung deutscher Zeitungen. Wiesbaden.
Bonfadelli, Heinz / Fähnrich, Birte / Lüthje, Corinna / Milde, Jutta/Rhomberg, Markus/Schäfer, Mike S. (Hg.) 2017: Forschungsfeld Wissenschaftskommunikation. Wiesbaden.
Conein, Stephanie / Schrader, Josef / Stadler, Matthias (Hg.) 2004: Erwachsenenbildung und die Popularisierung von Wissenschaft: Probleme und Perspektiven bei der Vermittlung von Mathematik, Naturwissenschaften und Technik. Bielefeld.
Enderli, Samuel 2014: Weblogs als Medium elektronischer Schriftlichkeit. Eine systemtheoretische Analyse. Hamburg.
forsa 2014: Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung auf die deutsche Sprache. Ergebnisse einer Befragung von Sprachwissenschaftlern. Berlin.
Göpferich, Susanne 1995: Textsorten in Naturwissenschaft und Technik. Pragmatische Typologie – Kontrastierung – Translation. Tübingen.
Koskela, Merja 2002: Ways of representing specialized knowledge in Finnish and Swedish science journalism. In: LSP & Professional Communication 2, Heft 1. URL: https://rauli.cbs.dk/index.php/LSP/article/viewFile/1942/1945[31.01.2019].
Mauranen, Anna 2013: Hybridism, edutainment, and doubt: Science blogging finding its feet. In: Nordic Journal of English Studies 13, Heft 1, 7–36.
Meiler, Matthias 2018: Eristisches Handeln in wissenschaftlichen Weblogs. Medienlinguistische Grundlagen und Analysen. Heidelberg.
Moss, Christoph / Heurich, Jill-Catrin 2015: Weblogs und Sprache: Untersuchung von linguistischen Charakteristika in Blog-Texten. Wiesbaden.
Niederhauser, Jürg 1999: Wissenschaftssprache und populärwissenschaftliche Vermittlung. Tübingen.
Schach, Annika 2015: Advertorial, Blogbeitrag, Content-Strategie & Co. Neue Texte der Unternehmenskommunikation. Wiesbaden.
Der Wandel von Denk- und Sprachstilen in der Sprachwissenschaft
Zur Textsorte ‚wissenschaftlicher Aufsatz‘ in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Ulla Fix
Gliederung
1 Vorhaben
2 Ludwik Fleck: Denkstil, Denkkollektiv, denksoziale Formen
Читать дальше