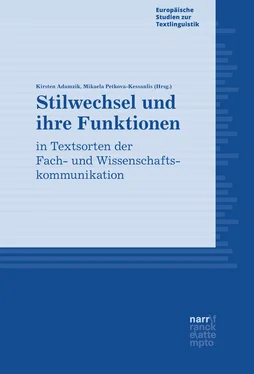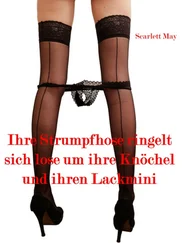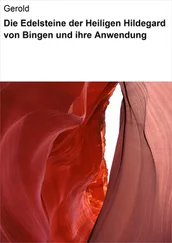2.1 Zum Denkstil 2.2 Zum Denkkollektiv 2.3 Zu den denksozialen Formen
3 Textsorte ‚wissenschaftlicher Aufsatz‘
4 Diskurslinguistisches Vorgehen: EIN-Text-Diskursanalyse
5 Kommunikationsbereich / Funktionalstil
6 Charakterisierung der Denkkollektive und Denkstile
6.1 Neoidealismus: Immanente Werkanalyse und Stilistik 6.2 Strukturalismus: Der Text als strukturelle Einheit 6.3 Pragmalinguistik: Der Text als kommunikative Einheit
7 Textanalyse
7.1 Spitzer:
Matthias Claudius’ Abendlied 7.2 Fucks / Lauter:
Mathematische Analyse des literarischen Stils 7.3 Sandig:
Stil ist relational! Versuch eines kognitiven Zugangs
8 Fazit
Das Thema des vorliegenden Bandes Stilwechsel und ihre Funktionen in Textsorten der Fach- und Wissenschaftskommunikation legt neben anderen Ansätzen auch den nahe, sich auf Überlegungen Ludwik Flecks zu Denkstil, Denkkollektiv und denksozialen Formen1 (Fleck 1980; 1983; 2011) zu besinnen und aus dieser Perspektive den Blick auf den Wechsel von Denk- und damit auch von Sprachstilen zu richten. Das lässt sich z.B. an sprachwissenschaftlichen Texten2 nachvollziehen, wobei es sich anbietet, Texte aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu betrachten, also aus einer nicht so weit zurückliegenden, noch von Zeitzeugen erlebten und bis heute nachwirkenden Periode. Ein solches Vorgehen verspricht zweierlei: Zum einen bedeutet es natürlich einen Gewinn für die Sprachwissenschaft selbst: Man kann einen − wenn auch sehr begrenzten − Einblick gewinnen in die Entwicklung des textsorten- und textstilbezogenen Zweigs der Sprachwissenschaft im genannten, von verschiedenen Denkstilen geprägten Zeitraum und damit wissenschaftsgeschichtliche Aufschlüsse erlangen. Zum anderen ergibt sich, indem man den Blick aus der Perspektive von Denkstil und Denkkollektiv auf den Text selbst richtet, diesen also als denk- und sprachstilgeprägte Äußerung betrachtet, auch ein erkenntnistheoretischer Gewinn. Diesem Ansatz will ich folgen.
In der mittlerweile vielfältigen Auseinandersetzung mit dem Fleck’schen Gedankengut hat das Interesse vorrangig der theoretischen Beschäftigung mit den von Fleck eingeführten Kategorien gegolten. Selten aber hat man sich, soweit ich sehe, der Betrachtung von Texten selbst mit Blick auf deren Denkstilgebundenheit, die sich am typischen Textsorten- und Stilcharakter der Texte zeigen müsste, zugewandt (vgl. Andersen u.a. 2018). Dabei lag und liegt es eigentlich nahe, das Phänomen eines Denkstilwechsels an den Textformen, wie sie für bestimmte Forschungsperioden mit deren Denkstilen typisch sein können, zu verfolgen. Genau das will ich nun versuchen, indem ich mich der Textsorte ‚wissenschaftlicher Aufsatz‘ zuwende, die auch in der Sprachwissenschaft eine zentrale Rolle spielt. Ich gehe davon aus, dass Veränderungen, die sich im Laufe der Entwicklung der Sprachwissenschaft bei dieser wie bei anderen Textsorten ergeben haben, Zeugnisse von Denkstilwandel sind. In diesem Zusammenhang wird die Fleck’sche Kategorisierung von Textsorten, also von „denksozialen Formen“ (Fleck 1980: 148), im Wissenschaftsbereich eine besondere Rolle spielen. Diese Kategorisierung wird zunächst vorgestellt und durch einen textlinguistischen Blick auf die Kategorien ‚Text‘ (Textsorte ‚wissenschaftlicher Aufsatz‘) und ‚Stil‘ (‚Funktionalstil‘) ergänzt.
Es folgt als erster, sicher noch unzulänglicher Versuch − der aber immerhin ein Anfang ist − eine knappe Charakterisierung des Denkstils je eines Denkkollektivs aus den Perioden des Neoidealismus, des Strukturalismus und der Pragmalinguistik. Im empirischen Teil des Beitrags soll das zuvor theoretisch Entwickelte am Fall eines wissenschaftlichen Aufsatzes der jeweiligen Periode im Sinne der EIN-Text-Analyse (vgl. Fix 2015) überprüft werden. Die Ergebnisse der textstilistischen Analyse werden – in Auszügen3 − auf das jeweilige Denkkollektiv und die „denksoziale Form“ des Aufsatzes bezogen. Es handelt sich um drei sprachwissenschaftliche Aufsätze, die man − mit aller Vorsicht − als typisch für eine Denkstilperiode ansehen kann. Es sind: Leo Spitzer: Matthias Claudius’ Abendlied (1960), Wilhelm Fucks/Josef Lauter: Mathematische Analyse des literarischen Stils (1965) und Barbara Sandig: Stil ist relational! Versuch eines kognitiven Zugangs (2001).
2 Ludwik Fleck: Denkstil, Denkkollektiv, denksoziale Formen
2.1 Zum Denkstil
Fleck prägt „als konzeptionelle Instrumente“, so Schäfer/Schnelle in ihrer Einleitung zur Neuauflage,
„die Begriffe des Denkkollektivs und des Denkstils . Ersterer bezeichnet die soziale Einheit der Gemeinschaft der Wissenschaftler eines Faches, letzterer die denkmäßigen Voraussetzungen, auf denen das Kollektiv sein Wissensgebäude aufbaut. Dahinter steht das epistemologische Konzept, dass Wissen nie an sich, sondern immer nur unter der Bedingung inhaltlich bestimmter Vorannahmen über den Gegenstand möglich ist.“ (Schäfer/Schnelle 1980: XXV; Hervorhebungen im Orig.)
Der Denkstil, so Fleck, legt fest, was innerhalb des Kollektivs als wissenschaftliches Problem, evidentes Urteil oder angemessene Methode angenommen wird. Was als Wahrheit gelte, könne nur in der „stilgemäßen Auflösung von Problemen“ (Fleck 1980: 131) bestimmt werden. Es geht ihm nicht um die Gestalt der Sprache, also den Sprachstil. Nicht die „Färbung der Begriffe“, so sagt er, und ihre Verknüpfung machen den Denkstil aus, sondern „ein bestimmter Denkzwang“ und „das Bereitsein für solches und nicht anderes Sehen und Handeln“ (ebd.: 85). Dieser Zwang evoziert und prägt die wissenschaftlichen Tatsachen. Fleck erwähnt in dem Kontext aber auch − wenngleich nicht systematisch − den Gebrauch der Sprache.1 So heißt es grundsätzlich: „Der Stil wird sich nach außen in einer gemeinsamen Sprache und gemeinsamen Institutionen, ähnlicher Kleidung, Häusern, Werkzeugen usw. realisieren“ (Fleck 1983: 170). Im Einzelnen geht es ihm dann z.B. um den Aufbau der Sprache, der schon etwas über den Denkstil aussage (Fleck 1980: 58), um Wörter und ihre Schärfe bzw. Unschärfe (Fleck 1983: 95ff.), um den Gebrauch als ‚Schlagworte‘ (Fleck 1980: 59), um bildliches Sprechen2 und vor allem um die Verwendung der Sprache als ‚Wissenschafts-‘ oder ‚Populärsprache‘ (vgl. ebd.: Kap. 4.4). Hier knüpfe ich an: Fleck zeigt am Sprachgebrauch, besonders an dem der Wissenschaftssprache, den Einfluss, den sprachliche Zeichen auf das Denken und die Herausbildung von Denkkollektiven haben können. An dieser Stelle kommt nun die Kategorie ‚Denkkollektiv‘ als „soziale Einheit der Gemeinschaft der Wissenschaftler eines Faches“ (Schäfer/Schnelle 1980: XXV) ins Spiel. Den Denkstil, so heißt es, „charakterisieren gemeinsame Merkmale der Probleme, die ein Denkkollektiv interessieren, […] Urteile, die es als evident betrachtet, […] Methoden, die es als Erkenntnismittel anwendet“ (Fleck 1980: 130). Weiter: „Ihn begleitet eventuell ein technischer und literarischer Stil des Wissenssystems“ (ebd.). Diese Erkenntnis hat Fleck aus der Beobachtung seiner eigenen Forschungstätigkeit, vor allem bei der kollektiven Arbeit im Labor, gewonnen. So kommt er zu der Auffassung, dass jede wissenschaftliche Tatsache ein historisch und kulturell bedingtes Phänomen sei und nicht einfach vorliege, sondern sich aus unterschiedlichen Diskursen ergebe. Fazit: Denkstile sind zeittypisch und kulturell-sozial geprägt – als Denk- und Sprachformen, über die Kollektive in einer bestimmten Zeit verfügen. Zum wissenschaftlichen Denkstil gehören „eine gewisse formelle und inhaltliche Abgeschlossenheit, […] manchmal besondere Sprache, oder wenigstens besondere Worte“, die „formal, wenn auch nicht absolut bindend, die Denkgemeinde ab[schließen]“ (ebd.: 136).
Читать дальше