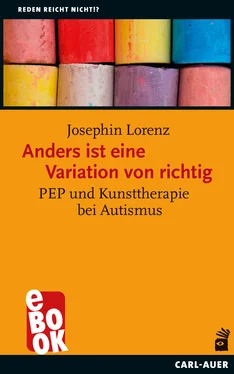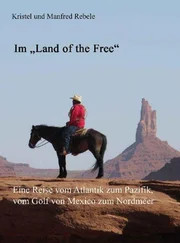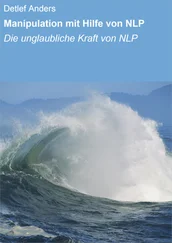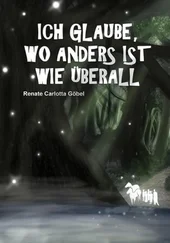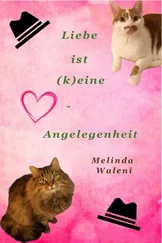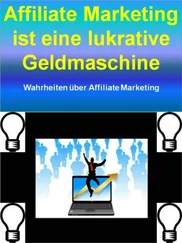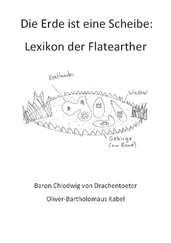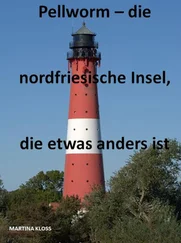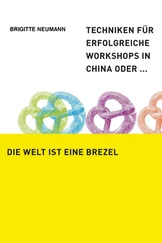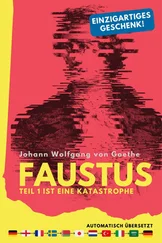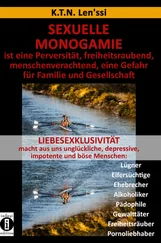Diese Vorstellungen und Erwartungen helfen nur leider in der Regel nicht weiter, um Probleme, mit denen ein autistisches Kind konfrontiert ist, zu lösen. Also gilt es, schon bei der Auftragsklärung mit den Eltern zu besprechen, welche Anliegen sie an die Unterstützung haben.
Anliegen der Familie können sein:
•Informationen über die Diagnose Autismus
•Analyse des individuellen Unterstützungsbedarfs
•autismusspezifisches, alltagsorientiertes Elterncoaching
•Unterstützung in Erziehungsfragen
•Stärkung von Handlungskompetenzen in Konflikt- und Krisensituationen
•Begleitung bei der Auswahl und Installation geeigneter Hilfen
•Teilhabemöglichkeiten für die ganze Familie
Manche Eltern sind über meine Fragen nach Ressourcen und Fähigkeiten ihres Sohns/ihrer Tochter verwundert, aber meistens können alle Eltern auch von Dingen berichten, die richtig gut gelaufen sind. Eine hilfreiche Orientierung bei der Suche nach weiteren Fragen und Lösungen sind für mich die drei Leitsätze, die Insoo Kim Berg und Steve de Shazer in ihrem Konzept der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie entwickelt haben:
1) Repariere nicht, was nicht kaputt ist!
2) Wenn etwas funktioniert, mache mehr davon!
3) Wenn etwas nicht funktioniert, wiederhole es nicht. Mach etwas anderes!
Besonders die Fragen nach dem, was schon funktioniert, oder besser, wann etwas funktioniert hat, sind hilfreich, um zu erforschen, mit welchen Problemen das Kind und seine Eltern zu kämpfen haben. Immer wieder suche ich daher in Beratungen mit Eltern nach Ansätzen, wo etwas schon gut geklappt hat. Das gleicht manchmal einer Detektivarbeit. Geeignet sind Fragen wie:
•Was läuft vielleicht trotz aller Probleme gut?
•Wann war es gut?
•Was war davor?
•Wie sah es dort aus?
•Wie war die Geräuschkulisse?
•Wer war dort?
Die Fragen scheinen manchmal banal, können jedoch Aufschluss darüber geben, wo das eigentliche Problem liegt. So rief mich eine Lehrerin nach den Herbstferien verzweifelt an und berichtete, dass mein Therapiemädchen plötzlich ständig den Unterricht stören würde. Gemeinsam fanden wir im Gespräch heraus, dass das Mädchen wohl durch den Ton der Neonbeleuchtung, die nach den Herbstferien morgens eingeschaltet werden musste, deutlich abgelenkt war. Da das Mädchen eine Schulbegleitung hatte, wurde verabredet, dass die beiden bei Bedarf das Klassenzimmer verlassen können.
Anliegen der Kinder und Jugendlichen
Eltern bzw. Sorgeberechtigte und das soziale Umfeld formulieren ihre Erwartungen, dass sich das Kind/der Jugendliche ändern soll. Interessanterweise haben die meisten Kinder ähnliche Wünsche. Die Erwachsenen sollen sich ändern, und dann sei alles ganz einfach!
Die Lösung für dieses Dilemma sollte nicht darin liegen, dass die Erwachsenen die jungen Klienten übergehen und nur selbst die Ziele definieren, die das Kind erreichen soll. Sie sind ebenso in der Verantwortung, eigene Wünsche und Erwartungen zu reflektieren, um so zu überprüfen, welche Handlungsmöglichkeiten sich in der Gemeinschaft auch für ein autistisches Kind eröffnen können. Und es gilt herauszufinden, was den Kindern und Jugendlichen wichtig ist, und sie mit ihrer Sicht der Dinge und ihren Anliegen dem jeweiligen Alter angemessen an diesem Prozess zu beteiligen.
Was will der junge Klient? Was genau soll sich verbessern? Denn darum »muss« das Kind ja zu mir kommen – weil sich etwas verbessern soll. Die Frage ist nur, wer oder was sich verbessern kann! Kann ein Kind sich vorstellen, was es sich von einer therapeutischen Begleitung wünscht? Kann es das schon in Worte fassen? Je nach Alter und Fähigkeit, sich mit Worten ausdrücken zu können, kann man diese Frage direkt stellen oder im Kontakt über nonverbale Ausdrucksformen (wie zum Beispiel im Spiel, beim Gestalten) klären.
Manchen Kindern fällt es sehr leicht, auf diese Fragen zu antworten. Sie sprudeln dann nur so vor Wünschen, was sich alles ändern soll. In ihren Augen sind es meistens die anderen Menschen, die sich ihnen gegenüber ungerecht verhalten. Sie können sich dann sehr ereifern, wie blöd, gemein und unmöglich diese Menschen sind. Sie fühlen sich unverstanden und wollen, dass sich das ändert. Aus ihrer Sicht müssen sich dazu natürlich die anderen ändern. Es gibt auch immer wieder Kinder, die sich wünschen, dass in der Schule weniger Anforderungen an sie gestellt würden. Und dann gibt es die, denen die Schule zu langweilig ist und die nach mehr intellektuellen Herausforderungen verlangen.
Und es gibt immer wieder junge Klienten, die ihre Wünsche nach Freundschaften oder im Jugendalter nach Partnerschaft und Liebe thematisieren. Die allgemeine Vorstellung, Autisten interessierten sich nur für Gegenstände und deren Eigenschaften und seien nicht an anderen Menschen und sozialem Miteinander interessiert, entspricht also nicht der Realität von Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Sicher gibt es viele dieser »Einzelgänger«, aber gerade Jugendliche aus diesem Spektrum thematisieren ihre Suche nach einem Partner/einer Partnerin. Sie wissen schon selbst, dass sie zu schnell zu sozialem Rückzug neigen oder Situationen vermeiden, in denen eine Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen möglich wäre. Sie wünschen sich Unterstützung dabei, wie sie mit der Überforderung und dem Stress umgehen können, der durch ihre besondere Wahrnehmung und Empfindlichkeit ihrer Sinne in sozialen Situationen ausgelöst wird. Dann gilt es, das Chaos menschlicher Gefühle, das durch (Liebes-)Beziehungen entstehen kann, gemeinsam zu sortieren und Strategien zu finden, die Freundschaften und Beziehungen ermöglichen.
Auch bei jungen Klienten ab einem Alter von 8 Jahren ist es wichtig, dass sie von Beginn der Therapie an wissen, dass sie weder passiv »behandelt« werden noch ich als Experte ihnen etwas »überstülpe«. Es geht mir darum, auf beiden Seiten – Klient und Therapeut – Klarheit über die Ziele der Therapie zu erhalten und diese zu benennen.
Je nachdem, wie stark die Haltung beim jungen Klienten ausgeprägt ist, dass die anderen alle doof sind – also auch ich als Therapeutin, muss ich mir etwas einfallen lassen, um mit dem jungen Klienten in Kontakt zu kommen. Die Kontaktaufnahme kann durchaus erst einmal nonverbal stattfinden. Das kann schon bei der Begrüßung anfangen. Eine »normgerechte« Begrüßung mit Handschlag kann für den Klienten schon die erste Überforderung im Kontakt sein. Oft sehe ich da bei meinen jungen Klienten ein erstes Augenleuchten, wenn ich einfach nicht meine Hand ausstrecke und auf einem höflichen Händeschütteln bestehe, sondern sie mit einem entspannten Winken mit der Hand begrüße. Es ist immer wichtig, achtsam zu registrieren, was dem Kind schwerfällt, um nicht etwas zu erwarten, was es nicht kann – wie zum Beispiel Augenkontakt, Stillsitzen oder das Ruhighalten seiner Hände.
Ich richte meine Kontaktaufnahme also auf die spezielle Erlebens- und Funktionsweise meines jungen Klienten aus. Wichtige Elemente für eine solche Kontaktaufnahme sind sicher sprachliche und spielerische Kreativität. Bei mitunter fehlender emotionaler Resonanz kann aber auch eine Haltung von Leichtigkeit oder ärgerlicher Zurückweisung der Beginn gemeinsamen kreativen Handelns sein. Wenn der junge Klient manches noch nicht in Worten ausdrücken kann, wird es dann auf einer nonverbalen Ebene vielleicht schon deutlich.
Mir ist es wichtig, gemeinsam zu erforschen, was hinter dem Wunsch liegt, »die anderen müssen sich ändern«. Meist können auch schon Grundschulkinder erfahrene Ungerechtigkeiten sehr genau formulieren, wenn ihre Ängste und Sorgen uneingeschränkt ernst genommen werden. Dabei geht es mir darum, den jungen Klienten zu unterstützen und sich nicht nur über sein Verhalten klarer zu werden, sondern auch das der anderen besser einordnen zu können. Gemeinsam suchen wir im Laufe der Therapie nicht nur nach möglichen Bewältigungsstrategien, sondern beschäftigen uns auch mit der Frage nach den dahinterliegenden Motiven.
Читать дальше