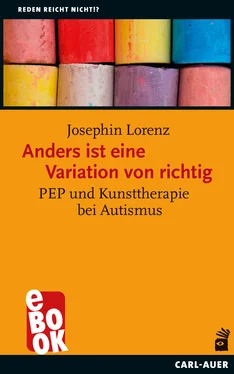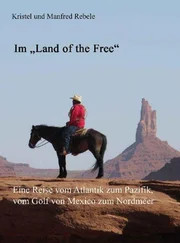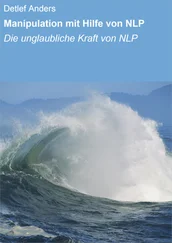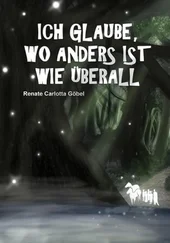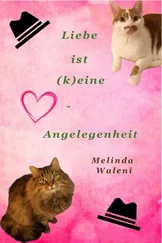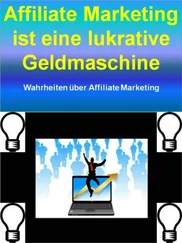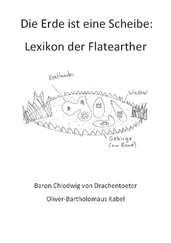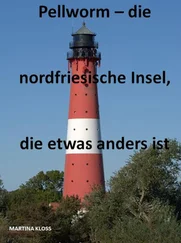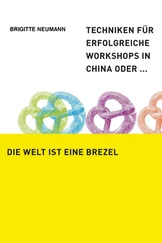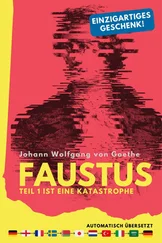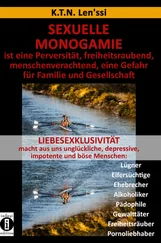Der Autismus lässt mich die Wörter anderer Menschen hören, macht mich aber unfähig zu wissen, was die Wörter bedeuten. Oder er lässt mich meine eigenen Wörter sprechen, ohne dass ich weiß, was ich sage oder auch nur denke.«
Temple Grandin, eine führende Tierwissenschaftlerin in den USA, beschreibt ihre eigenen autistischen Wahrnehmungen so (Grandin 1997):
»Als ich klein war, waren auch laute Geräusche ein Problem. Sie fühlten sich oft an, als träfe der Bohrer eines Zahnarztes auf einen Nerv. Sie verursachten tatsächlich Schmerzen. Platzende Ballons erschreckten mich zu Tode, weil sich das Geräusch in meinen Ohren wie eine Detonation anhörte. Geringfügigere Geräusche, welche die meisten Menschen ausblenden können, lenkten mich ab. Als ich im College war, klang der Haartrockner meiner Zimmerkollegin wie ein startender Düsenjet …«
Auch Sean Barron (1998) beschreibt seine Wahrnehmung als Kind sehr eindrücklich:
»Mir ist klar, dass ich fast meine ganze Kindheit hindurch meine Mutter einfach nicht hörte. Ihre Bemühungen, geduldig und lieb zu mir zu sein, drangen einfach nicht bis zu mir durch. Ich schenkte ihren Wörtern genauso wenig Aufmerksamkeit wie dem Geräusch eines Wagens, der die Straße entlangfuhr. Ihre Stimme war lediglich Hintergrundgeräusch. Nur wenn sie anfing zu brüllen oder zu schreien, drang sie zu mir durch und holte mich für kurze Zeit aus meinem Schneckenhaus.«
Ähnliches beobachteten die Gehirnforscher Henry und Kamila Markram. Ihre persönlichen Erfahrungen mit ihrem autistischen Sohn ließen sie so lange forschen, bis sie eine für sie schlüssige Antwort auf die Probleme mit ihrem Sohn fanden. 2007 veröffentlichten sie erstmals ihre »Intense World Theory«. Diese Theorie beschreibt, dass autistische Personen ein überempfindliches Gehirn haben und im Gehirn der Betroffenen eine permanente Reizüberflutung stattfindet. Aus diesem Grund ziehen sich autistische Kinder in bestimmten Phasen der Entwicklung aus dem Sozialleben zurück. Die Konsequenzen sind Schwierigkeiten im Umgang mit den Reizen.
Neurowissenschaftler (Velazquez a. Galán 2013) konnten errechnen, dass die Gehirnaktivität bei autistischen Kindern im Ruhezustand durchschnittlich um 42 % höher liegt als bei den anderen.
Das Wissen, dass Menschen aus dem Autismus-Spektrum die Sinnesreize aus der Umwelt ganz anders verarbeiten, ist für mich als Therapeutin absolut wichtig. Wenn ein Kind extrem überlastet zu mir in die Therapiestunde kommt, mich anschreit, auf Sachen einschlägt oder auch sich selbst verletzt, ist es sehr hilfreich herauszufinden, was diesem Verhalten vorausgegangen ist. Was war los? Warum? Warum schreit, kratzt, beißt er/sie? (Siehe dazu Kapitel 5»Das Wüte-Dings«)
2»Stimming« wird abgeleitet aus dem Englischen self-stimulating behavior = »sich selbst stimulierendes Verhalten« (s. auch Kap. 5).
2Unterstützung im Autismus-Spektrum
In den letzten Jahren häufte sich die Anzahl von Autismus-Diagnosen. Es wurde nach ADHS als die nächste Modediagnose gesehen. Steve Silberman schreibt in seinem Buch Die geniale Störung jedoch dazu:
»Diese zunehmende Zahl von Autismus-Diagnosen wurde zunächst als Zusammenspiel von genetischer Veranlagung und Risikofaktoren, die sich irgendwo in unserer toxischen modernen Welt verbergen: Luftverschmutzung, maßlosen Videospielen, denaturierte Lebensmittel.
Unsere DNA erzählt eine andere Geschichte. In der letzten Zeit gelangten Forscher zu der Feststellung, dass die meisten Fälle von Autismus keineswegs auf seltene De-novo-Mutationen, also spontane genetische Veränderungen, die erstmalig bei einem Familienglied auftreten und nicht ererbt sind, sondern im Gegenteil auf uralte Gene zurückgehen, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind und in manchen Familien lediglich konzentrierter auftreten als in anderen. Was immer Autismus ist – er ist kein singuläres Produkt der modernen Zivilisation, sondern ein eigenartiges Erbe aus ferner Vergangenheit, das durch Millionen Jahre der Evolution weitergegeben wurde.«
Es gab Autismus also schon immer, nur der Umgang mit den betroffenen Menschen hat sich mit der Zeit gewandelt. Je nach Beeinträchtigung wurden sie vielleicht in Heime abgeschoben, waren in ihren Familien als »Eigenbrötler« akzeptiert oder konnten sich bestenfalls auf Berufe spezialisieren, die ihren Fähigkeiten entsprachen. Schon immer gab es eine Bandbreite von Erscheinungsformen des Autismus und davon, wie das Umfeld damit umgegangen ist.
Heute gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten für Menschen aus dem Autismus-Spektrum, um kognitive und sprachliche Fertigkeiten zu entwickeln, die soziale Interaktion und Kommunikation zu trainieren und den Betroffenen somit ein Leben im sozialen Umfeld zu erleichtern. Die bisher etablierten und von der Wissenschaft als effektiv angesehenen Therapieverfahren basieren alle auf verhaltenstherapeutischen und übenden Ansätzen. Zusätzlich kann eine Vermittlung von wissenschaftlich fundiertem Wissen über Autismus den Betroffenen sowie deren Umfeld wie Eltern, Verwandte, Erzieher und Lehrer helfen, das Verständnis von Autismus und den Umgang damit zu verbessern.
In der Regel liegt in der Unterstützung der Betroffenen der Schwerpunkt bislang auf dem Erlernen von Fähigkeiten, die sie noch nicht beherrschen. Die dabei angewendeten Lehrkonzepte können den Menschen mit Autismus unter Umständen schwerfallen und in der Folge Stress auslösen. Je gestresster autistische Menschen sind, desto mehr neigen sie zu unerwarteten Verhaltensweisen. Übrigens ist es bei Menschen ohne Autismus sehr ähnlich: Je gestresster diese Personen sind, desto »verhaltens-origineller« werden sie.
Ein weiteres Phänomen wurde durch eine Studie der Autismus-Forschungs-Kooperation (AFK) deutlich – diese zeigt, dass Personen aus dem Autismus-Spektrum trotz größeren Hilfebedarfs und häufigerer Gedanken an eine ambulante Psychotherapie signifikant weniger Therapien gemacht haben. Laut dieser Studie lehnen Psychotherapeuten sie häufig mit der Begründung ab, sich mit der Diagnose nicht auszukennen. Personen aus dem Autismus-Spektrum haben also oft das Gefühl, dass eine ambulante Psychotherapie für sie schwierig zu bekommen ist. Die meisten Teilnehmer der Studie (85 %) empfanden die Kontaktaufnahme zu einem Psychotherapeuten erschwert (AFK 2015).
Das spricht deutlich für die Notwendigkeit des Wandels zu einer neuen Form der Psychotherapie, die Menschen aus dem Spektrum darin unterstützt, Stress abzubauen und ihre Stärken auszubauen. An dieser Stelle ist PEP für mich als Therapeutin eine wichtige Erweiterung der bisherigen psychotherapeutischen Ansätze. Zusätzlich wäre eine bessere Wissensvermittlung von autismusbedingten Stärken und Schwächen in den psychotherapeutischen Ausbildungen wünschenswert.
Diese Notwendigkeit des Wandels wird zunehmend auch von Fachleuten formuliert. So fordert Georg Theunissen (2014) in seinem Vortrag »Das Autismus-Verständnis im Wandel – von der Tradition zur Innovation« folgende Konsequenzen für die Begleitung von Menschen aus dem Autismus-Spektrum:
•Prävention in Bezug auf Stress oder Situationen, die womöglich Stress erzeugen
•Methoden zur Bewältigung von Stress und Würdigung
•Nutzung von Stärken und Spezialinteressen
Ausführlich hat er seine Standpunkte in dem Buch Menschen im Autismus-Spektrum: Verstehen, Annehmen, Unterstützen beschrieben.
Georg Theunissen folgend ist Prävention in Bezug auf Stress oder Situationen, die Stress erzeugen, ein wichtiger Punkt, der in der Autismus-Therapie zu beachten ist.
Wir alle wissen, wie wichtig es ist, Stress zu vermeiden. Auch ist uns bekannt, dass körperlicher und seelischer Stress auf die Dauer nicht gesund ist. Dennoch fühlen sich heutzutage immer mehr Menschen von Stress belastet. Kinder und Jugendliche haben Stress in der Schule, Studenten an der Uni, Erwachsene im Job. Wichtig ist es, dass Menschen mit und ohne Autismus erst mal erkennen, wo und warum sie Stress erleben, wie sie ihn ggf. reduzieren können oder wie sie mit unvermeidbarem Stress besser umgehen können.
Читать дальше