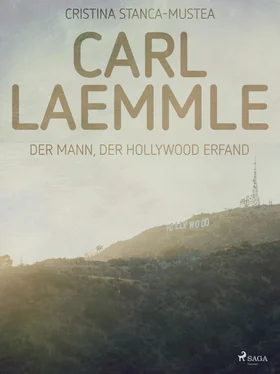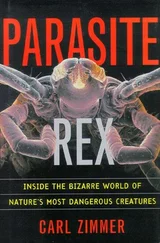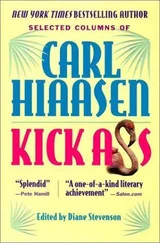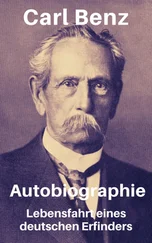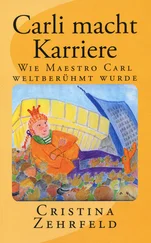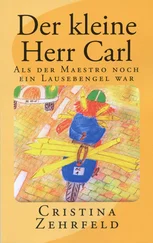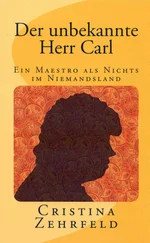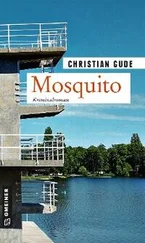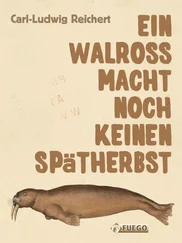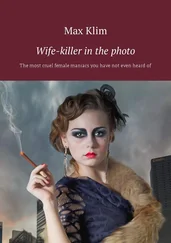Cristina Stanca-Mustea - Carl Laemmle
Здесь есть возможность читать онлайн «Cristina Stanca-Mustea - Carl Laemmle» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Carl Laemmle
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Carl Laemmle: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Carl Laemmle»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Carl Laemmle — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Carl Laemmle», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ungeduldig betrat Carl Laemmle Castle Garden als registrierter Passagier Nummer 334. Zusammen mit den anderen drei deutschen Jungen erhielt er seine Papiere, wurde untersucht und erhielt die Bestätigung, dass es ihm nun freigestellt sei, amerikanischen Boden zu betreten. Nun überkam Laemmle Wehmut. Er konnte all die anderen Einwanderer beobachten, auf die irgendjemand, ein Freund, Bekannter oder ein Familienmitglied, in der Neuen Welt gewartet hatte. Doch auf Carl Laemmle wartete niemand. Auch sein Bruder Joseph nicht. Ringsherum umarmten sich die Menschen und waren überglücklich, einander wiederzusehen. Laemmle stand inmitten dieser Menge und fühlte sich plötzlich allein.
Doch dann atmete er erleichtert auf, als sein Schulfreund Leo Hirschfeld den Arm um ihn legte. Auch auf ihn wartete niemand in der Neuen Welt. Laemmles Wehmut wich, als ein Bruder der beiden anderen Jungen auftauchte und das Quartett zu einem »Boarding House«, einer Art Pension an der Ecke 59 thStraße/3 rdAvenue, führte, in der man in einem Schlafsaal lebte und bleiben konnte, bis man in der Lage war, sich eine eigene Wohnung zu leisten. Dort verbrachte Carl Laemmle seine erste Nacht in der Neuen Welt.
Trotz des anfänglichen Schocks über die neue und lebhafte Stadt, die größer war als alles, was er bislang gesehen hatte, war Carl Laemmle nicht an einem völlig fremden Ort angekommen. In New York City existierte damals noch das sogenannte »Little Germany«, Kleindeutschland, nach Wien und Berlin die drittgrößte Ansiedlung von Deutschen in der Welt. Kleindeutschland allein war im 19. Jahrhundert etwa so groß wie Buffalo oder die Städte Milwaukee und Detroit zusammen. Mit teilweise über 200000 Deutsch-Amerikanern lebten nur knapp weniger Deutsche als Iren, die größte Einwanderergruppe dieser Zeit, in der Stadt.
Die damals etwas außerhalb liegende Lower East Side entwickelte sich zum Zentrum des deutsch-amerikanischen Lebens. Dort gab es deutsche Straßenschilder, Restaurants, Kirchen, Tageszeitungen, Feste und Vereine. Mit den Deutschen und den Iren kamen auch das erste Mal katholische Einwanderer nach New York, was den protestantischen Amerikanern ein Dorn im Auge war. Papisten und natürlich auch Monarchisten repräsentierten für die Amerikaner das Alte Europa – und dort sollten sie auch bleiben. Die Amerikaner fürchteten sich vor einer Verwässerung ihrer Gesellschaft durch die Deutschen, weil diese mehrheitlich keinerlei demokratische Traditionen und politisches Bewusstsein mit in die USA brachten und zudem – sofern katholisch – treue Anhänger des Papstes waren. Amerika sollte etwas Neues sein und nicht der Gesellschaft, Struktur und Politik der Alten Welt ähneln. Auch ließ sich das freizügige Leben und Feiern der Deutschen mit der puritanischen Lebensart der Amerikaner nicht vereinbaren. Ein besonderer Reibungspunkt waren die Sonntage, an denen sich die Deutschen oft mit der ganzen Familie in Parks oder Biergärten niederließen und in aller Öffentlichkeit Bier tranken, sangen und feierten. Für die amerikanischen Temperenzler war diese Verhaltensweise gottlos und vulgär.
Obwohl sich schon zu Beginn des Jahrhunderts deutsch geprägte Straßenzüge herausbildeten, konnte ein Kleindeutschland erst entstehen, als mit den Einwanderungswellen ab den 1830er Jahren auch Arbeiter und Handwerker aus Deutschland in die USA kamen. Ab 1840 kann somit von einem »Little Germany« als Wohnviertel der Deutschen gesprochen werden. Es umfasste den 10., 11., 13., und 17. Wahlbezirk, sogenannte Wards, der Lower East Side und war bis zum Ersten Weltkrieg das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Deutschen in New York. Es unterschied sich nicht nur rein optisch durch deutschsprachige Aushänge und deutsche Architektur von den amerikanischen Wohnvierteln, auch kulturell war hier manches anders. Unzählige Biergärten und Bierstuben entstanden entlang der Bowery Lane und sorgten für ein buntes Leben in der Öffentlichkeit. Zahllose Bälle, Sänger- und Turnfeste wurden von den Deutschen mit Paraden auf den Straßen gefeiert.
Carl hatte keinerlei Verwandte oder Bekannte, die im New Yorker Kleindeutschland lebten. Mit einer solchen Unterstützung wäre es viel leichter für ihn gewesen, eine Anstellung zu finden. Nach Laemmles Tod veröffentlichte die New York Times am 25. September 1939 einen Nachruf, in dem sie schrieb, dass Laemmle mit 50 Dollar in der Tasche in New York ankam, wo die Straßen damals mit Gold gepflastert waren. Laemmle sei aber bei seiner Ankunft so ernüchtert gewesen, dass er bereitwillig auch nur jede Anstellung angenommen hätte, die sich ihm bot. Er sei bereit gewesen, diese Anstellung auch sofort wieder aufzugeben, wenn ein anderer Arbeitgeber ihm auch nur ein paar Cent mehr bezahlt hätte. Laemmle war in den ersten Tagen wirklich verzweifelt. Sein Kapital schwand dahin, ohne dass er Aussicht auf eine Anstellung hatte.
Da nicht daran zu denken war, dass er trotz seiner Ausbildung als Buchhalter arbeiten konnte, nahm er schließlich einen Job als Laufbursche an und begann wieder ganz von vorne. Er verdiente vier Dollar in der Woche. Doch Laemmle zerstritt sich schon bald mit seinem Chef und hängte seine erste Anstellung an den Nagel.
Die vorhandenen Quellen geben keinen Grund dafür an, warum Laemmle seinen Bruder Joseph nicht schon vorher kontaktiert hatte. Einige Historiker vermuten, dass die Familie Laemmle keine Adresse von Joseph besaß, weil der Kontakt in den letzten Jahren abgebrochen war. Carl aber entschied sich nun – nach seinem missglückten Einstand in der Neuen Welt – nach seinem Bruder zu suchen.
Alles, was er über Joseph in Erfahrung bringen konnte, war, dass sein Bruder für eine deutschsprachige Zeitung in Chicago arbeitete: die Illinois Staatszeitung. Carl schrieb daher an den Herausgeber des Blattes und fragte nach dem Verbleib seines Bruders Joseph Laemmle. Die Antwort kam prompt und zu seiner Verblüffung von Joseph selbst: Er war der Assistent des stellvertretenden Herausgebers der Zeitung. In seinem Antwortschreiben an seinen jüngeren Bruder befanden sich außerdem zehn Dollar sowie ein Ticket von New York nach Chicago.
Laemmle wird Amerikaner
In einem Radiointerview, das Laemmle anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag seiner Einwanderung gab, erinnerte sich der Filmmogul: »Es war heute vor 50 Jahren, dass ich an einem nebeligen und regnerischen Tag als unerfahrener Junge aus Laupheim, Deutschland in die Vereinigten Staaten kam. Ihre Ohren sagen Ihnen bereits, dass ich noch immer nicht akzentfrei spreche, aber trotzdem bin ich glücklich, weil ich glaube, dass ich ein Amerikaner bin wie alle anderen, die mir jetzt zuhören. Denn ich bin mit Amerika aufgewachsen, als es seine schnellste Entwicklung nahm.« 3
Er unterstrich damit, dass er einerseits seinen »Migrationshintergrund«, an den sein deutlich vernehmbarer Akzent stets erinnerte, nicht leugnen wollte, er sich andererseits aber als Amerikaner fühlte und die meiste Zeit seines Lebens in den Vereinigten Staaten verbracht hatte. Laemmle war »akkulturiert«. Der Prozess der Akkulturation ersetzt heute viele ältere Erklärungsmodelle wie zum Beispiel den »Melting Pot« (Schmelztiegel) oder die »Salad Bowl« (Salatschüssel), um zu beschreiben, wie sich Einwanderer in die neue Gesellschaft einfügten und wie die neue Gesellschaft sich durch die Einwanderung veränderte.
Unterwegs nach Chicago wurde Carl klar, dass er sich anpassen musste, wenn er Erfolg in der amerikanischen Gesellschaft haben wollte. Der erste und wichtigste Schritt hierfür war das Erlernen der fremden Sprache. Die meiste Zeit der 40-stündigen Zugfahrt nach Chicago las Laemmle daher intensiv in einem deutsch-amerikanischen Wörterbuch und versuchte sich die allernotwendigsten Worte einzuprägen. Nun fühlte er sich besser vorbereitet auf das, was ihn in Chicago erwartete.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Carl Laemmle»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Carl Laemmle» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Carl Laemmle» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.