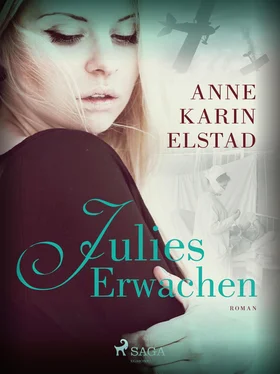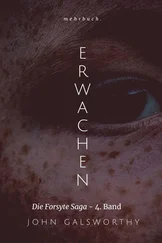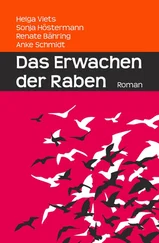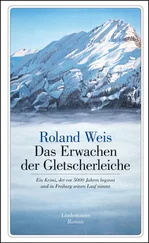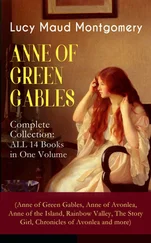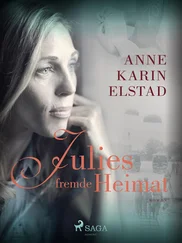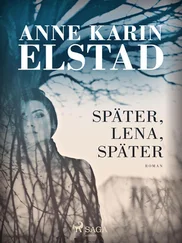Dort wird alles geräumiger und schöner sein als hier, aber Julie glaubt, daß sie den alten Laden vermissen wird. So wie es jetzt ist, befinden sich Laden und Lager im selben Teil des langgestreckten Gebäudes. Hinter dem Laden ist die Küche. Für Julie bedeutet das eine zusätzliche Sicherheit. Wenn sie irgend etwas fragen will, muß sie nur zu Ane hineinrufen, um Hilfe zu bekommen. Außerdem sind die niedrigen Räume gemütlich und anheimelnd. Auch wenn es mitunter eng wird, ist doch Platz für Waren aller Art. Alles, was aufgehängt werden kann, hängt an der Decke, kein Plätzchen in den Regalen und Schubfächern bleibt ungenutzt. Der Ladentisch ist rechtwinklig gebaut. Der eine Teil dient dem Aufmessen des Stoffes, der in den Regalen mit der Wäsche liegt. Am anderen Ende stehen die Waage und die Kartons mit den Messinggewichten sowie die Waren, die dort hingehören. Neben der Eingangstür steht die Brottruhe, wie sie genannt wird. In die große Kiste mit Deckel werden die frischen Backwaren gefüllt, die mit dem Schiff kommen. Die Brottruhe ist ein beliebter Sitzplatz für die Männer, die nachmittags gern in den Laden kommen, um Leute zu treffen und ein Schwätzchen zu halten. Manche benutzen sogar den Verkaufstresen als Sitzplatz. An manchen Abenden ist der Laden richtig voll, denn hier trifft man sich, um Neuigkeiten auszutauschen und sich zu unterhalten. Auf diese Weise erfährt Julie alles, was hier im Ort und sonst in der Welt passiert. Hier kommt ihr auch die Andeutung zu Ohren, daß Herr Fuglevik zu denen gehört, die es verstanden haben, ihr Schäfchen durch Krieg und schlechte Zeiten ins trockene zu bringen. Denn läßt er nicht ein Bauwerk von Ausmaßen errichten, wie man es in der ganzen Gegend noch nicht gesehen hat? In solchen Momenten hätte sie Lust, denen die passende Antwort zu geben, denn wie sie Herrn Fuglevik kennt, ist er die Rechtschaffenheit in Person. Und sie weiß nur zu gut, daß manche sich an den Zeiten gesundgestoßen haben. Daß sie nach Molde und nach Kristiansund fahren und Waren an Privatleute zu unverschämten Preisen verkaufen, Schwarzmarkt nennen sie das. Beispielsweise gibt es so gut wie niemanden, der Butter an das Geschäft liefert. Wenn sie so etwas hört, versteht sie erst recht nicht, wie sie es wagen können, ausgerechnet Herrn Fuglevik zu kritisieren. Hängt das damit zusammen, daß sie nur eine Frau ist und sie meinen, sie verstünde ihre Anspielungen nicht? Sie glaubt, daß es eher Neid ist, denn davon gibt es hier genug, genau wie anderswo.
Den meisten Gesprächsstoff liefert der große Krieg . Er ist viel näher herangerückt, seit sie hier ist. Der Ort hat zwei junge Männer auf dem Meer verloren. Das passierte im vergangenen Jahr im Frühling, dem Schreckensfrühjahr auf See, als viele norwegische Seeleute, deren Schiffe von deutschen U-Booten torpediert wurden, ihr Leben lassen mußten. Sie hatte davon in der Zeitung gelesen, aber das war so weit weg, und es war nur schwer vorstellbar, daß so etwas geschah.
Genauso schwer vorstellbar ist es, daß die grauenhaften Geschichten von dem Schützengrabenkrieg wahr sind. So viele Tote, es ist kaum zu fassen. Und wenn man sich das vorstellt und darüber nachdenkt, kann man den Verstand verlieren. So schrecklich ist das. Aber jetzt wird davon gesprochen, daß das bald ein Ende hat.
Das andere Thema, das diskutiert wird, ist die große Epidemie, die Spanische Grippe, von der das Land seit dem letzten Frühjahr heimgesucht wird. Jetzt hat sie den Ort erreicht. Die Männer senken die Stimme, wenn sie darauf zu sprechen kommen, die Krankheit verbreitet ein Grausen, das ihnen durch Mark und Bein geht. Einer erzählt, was er in der Zeitung gelesen hat: Als die Spanische , wie sie die Krankheit nennen, in Kristiania am schrecklichsten wütete, sind pro Woche sechs-, siebentausend Fälle gemeldet worden. Die Zeitungen waren voll von Todesanzeigen, und besonders unheimlich ist, daß so viele junge Menschen dahingerafft werden. Einige sterben schon wenige Tage nach Ausbruch der Krankheit, andere sterben an Lungenentzündung oder anderen Folgekrankheiten, und es gibt kein Mittel gegen diese Seuche. Die Einwohner der ländlichen Orte sollen sich gegen Ansteckung zu schützen versuchen, indem sie Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen meiden. Aber wie soll man sich schützen, wenn selbst die Luft, wie es scheint, Bazillen mit sich führt? Wer die Krankheit erst im Haus hat, muß sich doch um den Kranken kümmern. Bald wird berichtet, daß ganze Familien im Bett liegen, und eines Tages werden die ersten Todesfälle gemeldet. Im Abstand von ein paar Tagen sterben eine Mutter und ihr vierzehnjähriger Sohn. Kaum sind sie unter Anteilnahme der ganzen Gemeinde beerdigt, sterben zwei junge Männer. Der eine von ihnen ist Familienvater mit kleinen Kindern. An diesen Tagen ist es sehr still im Laden.
Julie erfährt, daß auch Odd die Krankheit bekommen hat, aber wie es aussieht, wird er wohl durchkommen. Eines Tages erhalten sie Bescheid, daß Solveig krank ist, und wieder ein paar Tage später muß Ane ins Bett. Nach den ersten Tagen voller Angst wird klar, daß auch diese zwei es schaffen werden. Um Ane kümmert sich Herr Fuglevik persönlich, er bringt ihr das Essen und wischt das Zimmer, in dem sie liegt. Weder Julie noch die Kinder dürfen den Raum betreten.
Julie muß nun alle Arbeiten übernehmen, die im Haus anfallen. Sogar die drei Kühe muß sie melken, morgens und abends. Sonst kümmern sich Solveig oder Ane darum. Ungeübt nach den Wochen, die sie von zu Hause fort ist, schmerzen ihr von diesem bißchen Melken Arme und Finger. Außerdem ist da noch all das andere, was es im Haushalt zu tun gibt. Herr Fuglevik ist von Anes Kochkünsten verwöhnt, und Julie steht Todesängste aus, daß sie nicht gut genug kocht. Eines Tages kommt auf sie zu, wovor sie sich am meisten gefürchtet hat, das Brotbacken. Herr Fuglevik weigert sich, gekauftes Brot zu essen, und so muß sie ran. Sie hat ja auch schon vorher Brot gebacken, zu Hause, aber da war die Mutter ständig dabei und paßte auf, daß alles klappte.
Nachdem sie den Teig in dem großen Trog geknetet hat, stellt sie ihn zum Gehen auf die Feuerholzkiste neben dem Ofen. Ihre Angst ist groß, daß ihr der Teig nicht gerät, wieder und wieder schaut sie unter das Tuch, weil sie fürchtet, daß er sich nicht richtig hebt. Jedesmal, wenn sie nachsieht, drückt sie einen Finger in die Masse, um zu kontrollieren, ob die Delle wieder weggeht. Zum Schluß sieht es aus, als ob eine ganze Hühnerschar über den Teig spaziert ist. Das Abbacken der Brote ist genauso schwierig. Der Ofen darf nicht zu heiß sein, sonst backen die Brote zu schnell, verbrennen außen und werden innen klitschig. Ist aber der Ofen nicht heiß genug, werden die Brote trocken und flach. Aus diesem Grunde muß sie mit jedem Holzscheit, das sie nachlegt, vorsichtig sein. Glücklicherweise geht alles gut. Auch wenn die Brote nicht so schön aussehen wie Anes, so bekommt sie doch ein Lob von Herrn Fuglevik, als er kurz hereinkommt und einen mit Butter bestrichenen und mit Zukker bestreuten Kanten probiert. Und als sie die abgekühlten Brote, eingeschlagen in weiße, frische Tücher, in die Kiste legt, da hat sie das Gefühl, eine große Leistung vollbracht zu haben.
So kommt es, daß der Alltag ihre geistigen und körperlichen Kräfte voll in Anspruch nimmt. Um Angst zu haben, ist sie viel zu müde in dieser Zeit. Daß sie selbst krank werden könnte, kommt ihr nicht in den Sinn. Am Abend tun ihr alle Knochen weh, und sie sehnt sich nur noch nach Schlaf und Ruhe. Sie schläft tief und traumlos, und wenn Herr Fuglevik sie morgens um sechs Uhr weckt, hat sie das Gefühl, gerade erst zu Bett gegangen zu sein. Schlaftrunken steht sie auf, zieht sich fröstelnd an, während sich in ihrem Kopf alles dreht. Unten in der Küche trinkt sie hastig eine Tasse Kaffee, die Herr Fuglevik für sie hingestellt hat. Dann eilt sie über den Hof, aus dem Stall schlägt ihr der morgendliche Gestank entgegen, von dem ihr übel wird. Aber all das kommt bloß von der Müdigkeit, krank ist sie nicht.
Читать дальше