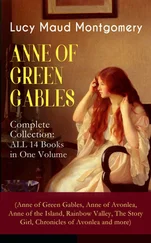Die Zunge könnte sie sich abbeißen. Nur Synna weiß, daß sie Gedichte an die Zeitung geschickt hat und einige davon abgedruckt wurden. Sie will nicht, daß andere davon wissen, denn auch das sind ihre Gedanken, von denen kein anderer etwas mitbekommen soll. Nicht einmal die Eltern wissen das. Der Vater könnte es schon erfahren, denn er würde das verstehen, mit ihm fühlt sie sich im Innersten verbunden. Aber die Mutter, die würde sich bestimmt aufregen und so etwas Hochmut und Grillen nennen. Jetzt fühlt sie sich ertappt, ausgeliefert und peinlich berührt.
»Wer hat denn das gesagt?«
»Als ich das Gedicht gelesen habe, wußte ich, daß es von dir sein mußte, und dann habe ich deine Schwester gefragt, und obwohl sie es bestritt, habe ich ihr doch angesehen, daß es von dir war. Außerdem war es auch mit J. R. signiert, und da wußte ich, daß du das bist. Ein schönes Gedicht, Julie, ich habe es aus der Zeitung ausgeschnitten.«
»Ich erlaube dir nicht, es jemandem zu zeigen und zu sagen, daß ich es geschrieben habe«, sagt sie aufgebracht. Sie entzieht ihm ihre Hand. Etwas zwischen ihnen ist zerbrochen, er hat etwas gesehen, das er nicht hätte sehen sollen. Sie fühlt sich nackt, und das ist ein quälendes Gefühl.
Sie sagt, morgen ist auch wieder ein Tag, ein Arbeitstag für sie, und er will ja wohl auch zeitig mit dem Dampfer von hier los. Da ist es das beste, schleunigst ins Bett zu gehen.
Davon will er nichts wissen. Er kommt mit wenig Schlaf aus, da wird sie das wohl auch schaffen. Sie ist doch wohl nicht beleidigt, weil er das mit dem Gedicht gesagt hat? Das war ja nun wirklich nicht seine Absicht. Er wollte doch nur sagen, daß es ein schönes Gedicht ist. Schließlich läßt sie sich überreden, noch ein Weilchen zu bleiben, aber über das Gedicht möchte sie nicht mehr sprechen.
»Was meinst du, Julie, was aus uns beiden wird?« fragt er und überrumpelt sie wieder mit einer dieser urplötzlichen Gesprächswendungen, die sie nun schon so gut kennt. Ihr wird heiß.
»Was meinst du damit?«
»Das weißt du nur zu gut. Aber ich werde nicht schlau aus dir. Manchmal glaube ich, daß du es auch ernst meinst mit uns beiden, aber beim nächsten Mal ist es wieder, als ob ich für dich gar nicht da bin.«
»Wir sind noch viel zu jung, um uns über solche Dinge den Kopf zu zerbrechen. Wir haben doch noch so viel Zeit.«
»Ich fühle mich nicht zu jung.«
»Über solche Dinge müssen wir nicht jetzt sprechen. Das können wir später immer noch tun.«
»Werden wir denn später dazu kommen?«
»Ich glaube schon. Nein, aber jetzt sollten wir diesen schönen Abend nicht kaputtmachen. Und ich muß augenblicklich nach Hause, sonst bin ich morgen kein Mensch.«
Da holt er ein kleines Schächtelchen aus seiner Brusttasche.
»Ich wollte erst sehen, wie der heutige Abend ausgeht, bevor ich dir das gebe. Es ist nur eine kleine Brosche. Pack sie zu Hause aus, hier ist es zu dunkel, um etwas zu sehen.«
»Vielen Dank, Ingebrikt, aber du sollst doch nicht . . .«
»Doch soll ich. Und eines will ich dir sagen, und zwar, wenn es mit uns beiden nichts wird, dann möchte ich, daß du die Brosche behältst, zur Erinnerung.«
Ach, wenn er doch so etwas nie gesagt hätte, denn das nimmt ihr etwas von ihrer Freude.
Bevor sie auseinandergehen, legt er die Arme um sie und zieht sie an sich. Als sie seine rauhe Wange an ihrer spürt, fühlt sie sich für einen Moment müde und hat ein merkwürdiges Gefühl im Körper. Aber als sie merkt, wie sich seine Arme fester um sie schließen, macht sie sich frei. Sie gibt ihm nur die Hand und verabschiedet sich. Seine Adresse in Molde hat sie, und wieder einmal haben sie einander versprochen zu schreiben.
Sie zieht die schwarzen Rollos herunter, bevor sie die Lampe anzündet und aus ihren Sachen schlüpft. Sie hängt alles schön ordentlich an seinen Platz, zieht das Nachthemd an und kriecht ins Bett. Erst dann öffnet sie das Schächtelchen und sieht sich die Brosche an. Sie ist wirklich schön, klein und oval mit einem leuchtend blauen Stein, eingerahmt in dunkles Silber. Sie wird sie morgen an den Kragen ihrer Alltagsbluse stecken. Er ist schon lieb, aber wenn sie daran denkt, was er gesagt hat, als er ihr die Brosche überreichte, daß er, bevor er sie ihr gibt, erst sehen wollte, wie der Abend ausgeht, ist ihr ein bißchen von der Freude über das schöne Geschenk genommen. Und sie denkt an ihr Gedicht, das in der Zeitung zu lesen war und in dem er sie wiedererkannt hat. Sie ist schon in einer absurden Weise verletzlich, und wie sie reagiert, ist unmöglich, aber was hilft es, sie hat das Gefühl, als ob es nicht mehr richtig ihr Gedicht ist. Sie weiß, daß es viele gelesen haben, es war ja abgedruckt in der Zeitung, aber keiner wußte, daß sie es geschrieben hat. Und die Vorstellung war wundervoll und aufregend. Aber er weiß es jetzt, und es kommt ihr vor, als habe sie dadurch etwas von sich selber verloren.
Nun sitzt sie da und wartet auf einen Brief von ihm. Sie hatten doch einander versprochen zu schreiben! Hat er das vergessen, oder wartet er darauf, daß sie zuerst schreibt? Aber das ist ja wohl nicht unbedingt üblich. Wieder verschwindet er aus ihren Gedanken. Die Erinnerung an die Stunden des Zusammenseins mit ihm verblaßt zu einem vagen Traum, der sie wehmütig stimmt. Ist es vielleicht nur der Traum, nach dem sie sich sehnt? Ist sie nur in die Verliebtheit selbst verliebt und gar nicht in ihn? Die Augenblicke dort unten am Kai formen sich zu einem wunderbaren Bild, das sie nicht mit Pinsel und Farbe malen kann, aber mit Worten kann sie es.
Ein Mondscheintraum
Mondhelle Nacht.
In scharfen Konturen die Berge stehn Wacht,
recken sich dunkel in den nachttiefen Himmel,
strecken sich hoch in das Sternengewimmel.
Still und traumesschwer
ruhet an felsigem Fuße das Meer,
– wie eine endlose Insel, schwarz und schön,
funkelnd im Lichtschein der Sterne aus unendlichen Höhn.
Stille und Frieden.
Nur der Gedanken Flug hebt ab uns von hienieden,
zu eilen in freudiger Furcht fremde Bahnen,
suchend die Reiche, die in der Ferne wir ahnen .
Doch nun genug;
ist eh bloß Blendwerk und Sinnesbetrug.
Verblaßt schon der Traum? – Es ist längst an der Zeit,
denn diese Sehnsucht führte wohl sonst noch zu weit.
Ging es so schnell?
Aller Zauberglanz gleich fort auf der Stell’?
Der Wolken Schwermutsgrau löscht die Lichterpracht.
Der Traum ist vorbei, übersteht nicht die Nacht.
Das Gedicht kam zu ihr, wie von selbst, ohne ihr geringstes Hinzutun. Es war wohl schon in ihrem Innern, mußte nur noch zu Papier gebracht werden. Es erstaunt sie immer wieder, wie leicht es ihr fällt, ihre tiefsten Gefühle in ein Gedicht zu fassen, wie genau sie darin ausdrücken kann, wofür sie sonst keine Worte findet.
Sie schreibt ihren Namen unter das Gedicht, steckt den Bogen in einen Briefumschlag und versiegelt ihn. Soll er doch denken, was er will. Noch bevor sie es sich anders überlegen kann, bringt sie den Brief zur Post und fühlt sich erleichtert, daß sie es getan hat.
Die Tage vergehen, ohne daß eine Antwort kommt. Was denkt er sich nur? Er muß den Brief doch schon längst bekommen haben. Vielleicht findet er sie und ihr Gedicht ziemlich einfältig. Unerträglich der Gedanke, daß er sie auslacht, sie und ihr kleines stümperhaftes Gedicht. Wenn sie jetzt darüber nachdenkt, wird ihr heiß vor Scham. Inzwischen findet sie es schrecklich unbedacht, daß sie ihm das Gedicht so Hals über Kopf geschickt hat. Typisch für sie, daß sie immer wieder Sachen macht, auf die kein anderer käme. Die Leute würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie wüßten, was für verrückte Streiche ihr einfallen. Aber so ist sie nun einmal. Das schlimmste ist, daß es ihr in ihrem tiefsten Innern nicht einmal leid tut. Sie bereut es nicht im geringsten.
Читать дальше