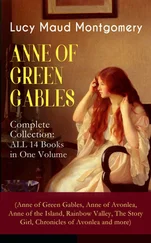Heute ist ihr freier Tag, der erste, den sie vollkommen frei hat, seit sie hier ist. Sie hat angeboten, beim Mittagessen zu helfen, aber Ane hat nein gesagt. Heute hat sie frei und soll keinen Handschlag tun, hat sie gesagt. Und noch ist es früh am Vormittag, der Tag, der vor ihr liegt, erscheint ihr unendlich lang, besonders wenn sie sich solche dummen Gedanken macht, die sie bedrücken.
Heute abend ist Tanz im Jugendhaus. Jetzt tut es Julie leid, daß sie Solveig, die tagsüber als Haushilfe kommt, abgeschlagen hat mitzugehen. Sie will mit ein paar anderen Mädchen aus dem Ort dorthin. Julie hat nein gesagt, weil sie sich hier noch fremd fühlt. Jetzt ärgert sie sich darüber. Wie soll sie mit den jungen Leuten hier Bekanntschaft schließen, wenn sie nicht mit ihnen ausgeht? Typisch für sie, sich so zu zieren. Wo sie doch schon die zwei Brüder kennt, die sich an den Nachmittagen im Laden herumdrücken. Sie kaufen ein paar Kleinigkeiten, sitzen aber meistens auf der Brottruhe und scherzen mit ihr, so daß sie schon mehr als einmal rot wurde und aus dem Konzept geriet. Sie mag die beiden, aber sie weiß nicht, welcher ihr besser gefällt. Na, darüber muß sie ja nicht jetzt nachdenken. Denn obwohl sie nun achtzehn ist und erwachsen, hat es keine Eile damit, nicht im geringsten. Sie wird sich nicht fest binden, noch lange nicht, weil sie Träume hat, ja, die hat sie. Aber ärgerlich, daß sie die Einladung zum Tanz ausgeschlagen hat. Allein kann sie nicht gehen. Damit würde sie sich im ganzen Ort blamieren. So darf sie jetzt schön allein sein und sich selbst bemitleiden. Aber das ist schließlich ihre eigene Schuld.
Nicht auszuhalten, hier drinnen zu sitzen und zu grübeln, sie muß hinaus. Sie hat sich ein Plätzchen ausgeguckt, eine Anhöhe oberhalb der Kirche. Wenn sie dorthin geht, kann sie das Meer sehen.
Sie sitzt auf einem flachen Felsen und sieht in die Ferne. Weit draußen, wo der Himmel und das Meer ineinander übergehen, schimmert blau der Horizont. Die See hat das leuchtende Blau des Septemberhimmels angenommen, schwingt sich auf zu schaumweißen Wogen, die sich über nackte Felsen und Strand, über Pfähle und Kaianlagen ergießen, so daß sie es bis hier oben hören kann. Landeinwärts ragen die Konturen der Bergrücken auf, die schneebedeckten Gipfel von der Sonne vergoldet. Die Landschaft mit den verstreut liegenden Gehöften glüht in den Herbstfarben, rot, gelb, goldbraun, gesprenkelt mit dem sanften Grün der Espen. Der Tag ist kühl. Obwohl die Sonne an einem klaren Himmel steht, beißt der frische Wind an Wangen und Ohrläppchen.
Von hier kann sie den ganzen Ort überblicken, mit der Kirche, den Bauernhöfen und den kleineren Häusern, dem langgestreckten, weißen Gebäude mit dem Laden, wo sie jetzt wohnt. Schön ist es hier, so schön, daß es ihr die Brust zusammenschnürt, so schön, daß sie am liebsten ein Gedicht schreiben würde über diesen Anblick. Eines Tages wird sie es tun. Wenn sie es überhaupt schafft.
Oh, wie sehr sie doch den Herbst liebt. Wenn andere sagen, sie sehnten sich nach dem Frühling, dann denkt sie, Sehnsucht nach dem Frühling, nein, nach dem Herbst, das ja. Der Frühling ist gefährlich, mit allem, was da grünt und sprießt, mit seiner alles überwältigenden Lebenskraft. Der Herbst aber in seiner Farbenpracht ist so schön, daß es schmerzt. Die Gewißheit, daß bald alles vorbei ist, daß diese Zeit so kurz ist, Wehmut und Trauer wie ein verborgener Strom in all der Schönheit. Die Rastlosigkeit, die Unruhe, die sie in dieser Zeit packt. Auch das Gefühl, daß sie das alles festhalten muß. Ob sie das vielleicht so empfindet, weil sie ein Herbstkind ist?
Im Herbst, sagt man, stirbt alles, Laub und Gras und Blumen. Aber ihre Blumen nicht, denn das sind ihre Träume und ihre Sehnsucht. Blumen, die nie verblühen.
Die Niedergeschlagenheit ist verflogen. Der Brief von zu Hause kommt bestimmt morgen, und tanzen gehen kann sie immer noch. Sie hat noch viel Zeit. Langweilen muß sie sich in ihrem Zimmer auch nicht. Sie hat ja noch die Bücher. Inzwischen kennt sie die Bibliothek, einmal in der Woche ist sie abends geöffnet. Gerade hat sie »Jenny« von Sigrid Undset angefangen, und obwohl sie das Buch schon einmal gelesen hat, ist es wieder genauso spannend wie beim ersten Mal. Damals hat sie es regelrecht verschlungen. Jetzt läßt sie sich mehr Zeit und entdeckt ständig neue Sachen, über die sie sich wundert. Dabei fehlt ihr Synna, denn sie haben immer dieselben Bücher gelesen und hinterher darüber gesprochen. So hatten sie immer noch lange nach der Lektüre eines Buches etwas davon. Besonders bei Büchern, die sie in aller Heimlichkeit ausgeliehen hatten. Bücher, die die Mutter nicht sehen sollte. Solche wie »Jenny«. Die Mutter ist in dieser Beziehung ziemlich prüde. Vielleicht gar nicht so verwunderlich, denn wenn Julie einzelne Stellen in solchen Büchern liest, kommt es schon vor, daß sie rot wird, auch wenn sie mutterseelenallein im Zimmer ist.
Auf dem Weg nach Hause sieht sie jemanden auf sich zukommen, und je näher er herankommt, desto mehr kommt ihr an der Gestalt irgend etwas bekannt vor, an der schlaksigen Art zu gehen. Das kann doch nicht möglich sein . . .? Aber doch, es stimmt, das ist Ingebrikt, der Freund aus Kindertagen. Die Röte, die sie im Gesicht aufflammen spürt, geht zum Glück wieder weg, bevor er heran ist. Was er hier wohl macht? Jedenfalls ist ihm anzusehen, daß er sich über die Begegnung freut. Feierlich streckt er ihr die Hand entgegen:
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Julie.«
»Danke, aber woher weißt du das?«
Am vergangenen Wochenende war er zu Hause, erzählt er, und da hat er ihre Mutter im Laden getroffen. Als er erwähnte, daß er dieses Wochenende zu einem Schulfreund, der hier im Ort wohnt, nach Hause eingeladen ist, hatte sie ihn gefragt, ob er nicht ein kleines Päckchen für Julie mitnehmen würde. Das hat er getan, und das Päckchen ist bereits abgegeben.
»Du bist bei Fugleviks gewesen?«
»Ja, und ich habe mich richtig wohlerzogen benommen.«
»Und ich dachte schon, die zu Hause hätten mich vergessen.«
»So leicht ist es nun ja nicht, dich zu vergessen, Julie.«
Jetzt ist nicht nur der Wind schuld an ihren roten Wangen, die nun wohl nicht mehr zu übersehen sind. Daß er aber auch so etwas sagt.
Nach der ersten Verlegenheit redet sie wie ein Wasserfall. Wie geht es zu Hause? Was macht dieser und jener? Sie denkt, was sie schon so oft gedacht hat: Wie gut man sich mit Ingebrikt unterhalten kann. Und er weiß über vieles Bescheid, redet kein dummes Zeug daher. Das wäre ja auch noch schöner, er als Lehrersohn. Noch dazu, wo er im Frühjahr das Abitur macht, und davon kann sie wie die meisten jungen Leute aus ihrem Ort nur träumen.
Sie haben sich so viel zu erzählen, daß sie ganz überrascht ist, wie schnell sie zu Hause angekommen sind. Erst da fragt er sie, ob sie heute abend zum Tanz geht.
»Nein, ich glaube nicht.«
»Hast du denn keine Lust?«
»Ja, schon, aber ich habe niemanden, mit dem ich hingehen könnte.«
»Du kannst doch mit uns mitkommen.«
»Aber das geht doch nicht. Was glaubst du, was die Leute dazu sagen würden?«
»Habe ich nicht schon erwähnt, daß ich mich gut benehmen kann, wenn ich will?«
»Ja, aber . . .«
»Gut, dann holen wir dich um sieben ab.«
Bevor sie noch etwas einwenden kann, hat er ihr die Hand gegeben und sich verabschiedet.
Sie bleibt stehen und sieht ihm nach, wie er die Straße hinuntergeht, an den Kais vorbei und am Strand entlang. Eine hoch aufgeschossene Gestalt, die schwarze Schirmmütze mit der schmalen Krempe sitzt lässig hinten im Nacken auf dem gelockten blonden Haar. Die eine Hand in der Tasche, die andere frei schwingend. An der Art, wie er geht, sieht sie, daß er pfeift. Und es scheint ihn nicht im geringsten zu stören, daß Jacke und Hose viel zu kurz sind. Jetzt tritt er nach einem Stein und dreht sich einmal auf der Stelle im Kreis. Wie süß er jetzt ist! Was würde er wohl antworten, wenn sie ihm sagte, daß er süß ist?
Читать дальше